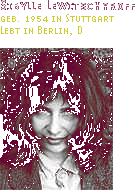
PONG
Einem Verrückten gefällt die Welt wie sie ist, weil er in ihrer Mitte wohnt. Nicht irgendwo in irgendeiner Mitte, sondern in der gefährlich inschüssigen Mittemitte, im Zwing-Ei. Ein unbedacht aus diesem Heikelraum weggerücktes Haar brächte die Welt ins Wanken und dann auf Schlingerkurs Mond Sonne Milchstraße ade systemwärts e´- e´. Das alles weiß der Verrückte genau und hütet sich, zum Beispiel seinen Arm in eine zu hohe Grußstellung zu heben, damit nicht Unglücke geschehen, Felsbrocken herabstürzen, große Brocken auf kleine, noch größere auf schon stattliche, und die zarten Angeln zerbrechen, in denen die Welt hängt. Ihm, das versteht man ja leicht, sind nur winzige Bewegungen erlaubt, und es schmerzt ihn, wenn man ihn von einem Bett ins andre trägt oder in ein schiefes Zimmer stellt, denn er liebt die Welt wie sie ist, er liebt sie, er liebt sie. Und sonst? Noch irgendwelche Sorgen? Ja. Leider Sorgen die Menge.Die Sorge, daß ein Knopf abspringt.
Die Sorge, daß man ihn bloß hingekritzelt hat.
Die Sorge, daß seine himmlischen Verbindungen verlorengehen.
Die Sorge, daß man durch seinen Nabel Frost einbläst.
Die Sorge, daß falsche Gemahlinnen ihn bei Gericht verklagen.
Der Mann besteht aber nicht nur aus lauter Sorgen und Vorsicht. Plötzlich bekommt er einen gewaltigen Appetit. Obendrein einen Durst, der ihn befähigt, den Pazifischen Ozean auszusaufen. Wieder was weggemacht, beglückwünscht er sich nach jedem Schluck und Bissen. Bald ist sein Leib geschwollen, weil schon die ganze Welt darin Platz genommen hat und ein vielfäustiges Herrenleben in ihm führt. Fliegt da noch irgendwo ein Mauersegler und stößt einen kleinen Mauerseglerschrei aus, tut der Mann den Mund auf, und damit gut. Warum also sollte er die Welt nicht lieben. Es gibt keinen Grund.
Ihm gefällt aber nicht nur die Welt als Ganzes, sondern auch in ihren Teilen. Teilen, die womöglich schadhaft sind und trotzdem von ihm geliebt werden, ja gerade darum mit einem Herzen, das dringlich an die Innenwand des Leibes klopft, geliebt werden.
Es fängt damit an, daß der Mann erkennt, wie die Welt in allen ihren Einzelheiten, und bevorzugt in ihren kleinsten, eine Botschaft für ihn bereithält. Das Lindenblatt, das vor ihm im Wind glitzert, bekennt seine Mitschuld am Tod des Nibelungen Siegfried und fordert ihn auf, einmal mit dem Finger über es zu streichen und die kaum mehr zu tragende Schuld fortzuwischen. Er tut es und hat nun einen Tropfen fremder Schuld am Finger hängen. Als ein zu frischen Taten aufgelegter Schmerzensmann verläßt er den Garten.
Er läuft auf der Straße einer stark parfümierten Frau hinterdrein, die ein Kind mitzerrt und häßlich auf es hinunterredet. Heldenhaft macht sich der Mann daran, das ihm ekelhafte Parfüm, dessen verheerende Wirkung auf das Kind er fühlt, einzusaugen, damit ein reiner Luftraum entsteht, in dem das Kind atmen und einen Gedanken in Schönheit denken kann. Es fruchtet natürlich wenig, das ist dem Mann klar, aber eine Scheu, sein Vorhaben möchte falsch ausgelegt werden, hindert ihn, vor der Frau herzulaufen und dort ihr Parfüm wegzuatmen, wo es ja viel wirkungsvoller wäre. Er faßt sogar den Plan, das Kind bei der Hand zu nehmen und ein Stückchen mit ihm zu rennen, läßt es aber sein, weil er ihn abgeschmackt findet, den Wettlauf Gut gegen Böse. Bald darauf macht er sich Vorwürfe, daß es ihm an Mut gefehlt hat.
Derselbe, dem wir sein gutes Herz gleich angemerkt haben, befindet sich wenig später als Sitzperson im Taxi. Was ist mit dieser werten Person? Hat ihre Leibhülle ein Loch bekommen, vielleicht an dafür nicht vorgesehener Stelle? Ihre Hände jedenfalls haben jetzt Zitterfinger, zu nichts gut. Was geht im Kopf des Mannes vor? Warum sind seine Augen so starr? Es ist das Flimmerheer der tausend Zeichen, das seinen Kopf malefiziert, Kurfürstendamm, die breite Einfahrt zur Hölle, Blinkzeichen rechts ein Nebenabzweig zur Hölle, Blinkzeichen links dito, alle Zeichen dito, Fisch im Bikini dito dito, Befehle von überallher, Bleibtreu-Befehl, Uhland-Uhrzeigbefehl, Litzenfehl-Obachtbefehl, Fasanen-Rupfbefehl, zig zig Eisschleckbefehle, Bratbefehle, Ohrverderbbefehle, Lupf-die-Tassen-Befehle, Hosenplatzbefehle, Blutacker, ein schlimmer Haarbürstbefehl, Blutacker, ein Erbrechen von Grün ein Erbrechen von Gelb ein Erbrechen von Rosa, und Zähne und Lichter und wehendes Haar, die tückischen Verschwörer lächeln, und nirgends der felsige Pfad um die Biegung hinauf, und keine Mulde wohinein die Hände und kein Loch wohinein der Kopf und keine Grube dahinein der Leib. Seinen Schamhut stülpt der Verrückte über die ganze arme Person, Salpeterblumen brechen aus seiner kalten Haut, und gewiß wird er bald schreien, doch bevor er dies tut, wenden wir uns ab. Wozu sollte uns kümmern, daß jemandem die Welt nicht gefällt wie sie ist.
Es ist an der Zeit, den Mann mit Namen vorzustellen. Er heißt Pong.
Nur Pong. Die, wie man sagt, äußere Erscheinung von Pong? Mittelgroß,
nicht alt, nicht jung. Blond! Gewiß ein nicht unschöner Mann.
Zumal er Ohren hat, die durch die Spitzen seiner dünnen Haare brechen,
Ohren, mit denen er ängstlich auf alles hört. Sein Gesicht ist
kein Haufen, auf dem alles wild durcheinanderwächst, es ist ein von
hoher Hand geordnetes Experiment, und die Augen darin sind vollkommen.
Ins Graue, ins Grüne spielende Augen. Unter ihnen ein Polster aus
Drüsenflüssigkeit, aber nicht zart, nicht vom Weinen, nicht
von Kummer geschwollen, sondern eher hart wie Schwielen.
Ist etwas an dem Mann, was das Ballhafte oder Fausthafte im Namen Pong
rechtfertigt? Auf den ersten Blick nicht. Wenn man aber die Sprungbereitschaft
des ganzen Körpers nimmt - nie kommt es allerdings zum Sprung -,
dann ja. Pong könnte sich, wenn er den Ehrgeiz dazu hätte,
wie ein Vollgummiball durch die Straßen bewegen, vielleicht nicht
ganz bis zum Fenster des ersten Stocks hochschnellen, aber bei den Leuten
blitzartig im Erdgeschoßfenster erscheinen, das schon. Was er aus
Rücksicht auf seine Umgebung nie tut. Die herrlichen Federn in seinen
Gelenken ließen es aber zu.
Wem verdankt er diese Befähigung, die ihn so leicht berühmt
und zu einem Liebling der Frauen hätte werden lassen können?
Es heißt, der Mutter. Von dieser Mutter, noch weniger vom Vater,
ganz gewiß nicht von irgendwelchen Geschwistern, die ihm gern angedichtet
werden, möchte er etwas wissen, noch mit Vergleichen zwischen ihm
und den Eigenschaften dieser sogenannten Familie belästigt werden.
Er steht hier vor einer unlösbaren Aufgabe, denn das Abschütteln
der Verwandten verlangt Kraft, Spitzfindigkeit, verlangt, daß man
die Beine setzt wie eine Gemse, aber auch, daß im rechten Moment
nach der Peitsche gegriffen und nicht etwa davor zurückgeschreckt
wird, die Rücken der Verwandten damit zu bestreichen. Erlahmen die
Kräfte auch nur für einen Augenblick, ist man einmal zerstreut,
kleben sich die Verwandten unbemerkt wieder an einen an und spielen sich
als unentbehrliche Lebensbegleiter auf.
Will er zum Beispiel paar Schritte tun, tritt er gut gelaunt, ausgerüstet
mit Regenhaut, Stock und Hut vor die Schwelle seines Hauses, wird jeder
weitere Schritt von einem Baum vereitelt, der sich ihm in den Weg stellt.
Nicht schwer zu erraten, welcher Baum ihm diesen Tort antut. Es ist der
vermaledeite Stammbaum, auf den sich die Verwandten geflüchtet haben,
um ihn von hoch oben, wo sie anscheinend sicher in ihren selbstgebastelten
Nestkörben hocken, auszuzanken. Natürlich wehrt er sich, hat
aber nur eine Nagelschere zur Verfügung, mit der schneidet er Rindenstücke
weg und vertieft die Ritze, die er dem Baum bei ihrer letzten Begegnung
beigebracht hat. Während er unten mit unzulänglichem Werkzeug
herumkratzt, treibt die Mutter im Wipfel ihr Unwesen und lacht.
Er übertreibt freilich, wenn er behauptet, daß ihm das Verwandten-Abschütteln
so schwer falle. Im Grunde ist es ja im Gegenteil sehr leicht. Wenn man
das Problem von Adam her durchdenkt, ergibt sich ein anderes Bild. Unter
dem titanisch dicken, titanisch langen Arm des Erzvaters drängeln
sich Millionen von immer kleiner immer dünner immer blasser werdenden
Menschen, der Ausläufer des Arms ist ein schlanker, an seiner Spitze
nurmehr fadendünner Zeigefinger, und das Ende dieses Fadens ist provisorisch
mit einer Eiderdaune und etwas Hühnerdung auf dem Kopf von Pong festgeklebt,
eine ruckhafte Bewegung mit diesem Kopf, und er ist den alten Adam mitsamt
den Adamskindern und Adamskindeskindern los. Dann möchte er das Lachen
der Mutter hören! Dann möchte er erleben, ob sie noch den Mut
hat, ihm fünf Geschwister anzuhängen! Er kommt sich mit einem
Mal gewitzt vor, ist gleichsam ein Senffaß voll mit überscharfem
Senf, den sich keiner mehr so leicht auf die Wurst schmiert.
Der Stammbaum wird in Zukunft einfach umgangen und links stehen gelassen,
die Gespensterverwandten werden nicht mehr mit Gedanken dickgefüttert,
ihnen wird keine Gelegenheit mehr gegeben, durch Kalkül und Kommentar
auf ihn einzuwirken. Aus dem Morgendämmer will er eine Genealogie
heben, in der er sich herleitet; man soll dieses Wunder an Selbstverzweigung
nur aufmerksam studieren und daraus seine Lehren ziehen.
Zuerst wird er die falsche Ahnenliste zerstören, die überall
in den Rathäusern ausliegt, in denen seine gesammelten Scheinverwandten
auf ihre Existenz pochen, ansonsten aber ein Bummelleben führen.
Stempel, Papier, Unterschriften, alles gefälscht. Die Akten schmutzig
vom Schweiß der Betrüger. Er frißt einen Besen, wenn
auch nur die kleinste Angabe der Wahrheit entspricht. Rein sei Pong, rein
was er denkt, rein was er berührt. Eine erste Ahnung dieser Reinheit
teilt sich seinen Fingerspitzen mit, die in prickelnder Selbstgärung
beginnen, sich von all dem angehäuften Schmutz zu befreien. Alles
lenkt sich ins Weite, entstrickt sich, rafft sich zu einem Hoffen Möchten
Können auf, von dem er bisher nichts geahnt hat. Er wird jetzt eine
Brücke zu Gott schlagen, was sich im Sturzgold früher Sonnenstrahlen
jauchzend bestätigt. Wolken mit schräggekämmtem Haarflor,
hinter denen ER sich verbirgt und auf seinen Scheitel schaut, sind in
den Himmel gehängt. Schnüre langen von ihm bis dahin. Seine
Trostbändel! Aus himmelseingeborenem Stoff, helle flüssige schlenkerige
Fragen hinauf, klare kurze wohlgeletterte Response hinabschreibend.
Eine Schule des Glücks und kein Gesudel.
Zunächst die Frage, wie kam Pong in die Welt. Eine so bedeutende
Singularperson, wie sie ja Pong unzweifelhaft ist, kommt nicht durch gewöhnliche
Vermehrung in die Welt, sondern auf dem Wege der Vermehrung durch Entzweireißen.
Für die Hervorbringung von Pong wurde eine andere, nicht besonders
bedeutende Person, bedeutend allerdings im Hinblick auf Pong, zerrissen.
Diese Ursprungsperson mag gut und freundlich oder windig und launisch
gewesen sein, es interessiert nicht. Was aber interessiert, ist, daß
diese im Grunde eher gewöhnliche Person den Entschluß faßte,
einmal, und sei es nur für eine Sekunde, ganz der Wahrheit zu leben.
In diesem unerhörten Moment legte sich aller Radau. Aus der bisherigen
Person, nennen wir sie ruhig Hanna Faiß, wurde alles Unnütze,
nicht auf die Wahrheit, nicht auf Pong hinarbeitende, mittels Ausblasen
vertrieben. Eine Stille, die allen Geschöpfen die Ohren lang machte,
setzte sich wie leuchtender Rahm auf die Welt, und es begab sich der Große
Ratsch.
Pong war da. Schon groß. Mit allen Zähnen, allem Haar. Konnte
laufen, konnte sprechen. War gescheit! Ob ein Mensch durch normale Geburt
oder durch den Großen Ratsch in die Welt kommt, erkennt man an seiner
Oberfläche. Der Normalbürtige hat die erst glatte, später
faltige Schlüpfhaut der Blutgeburt. Pong aber hat die Spezialhaut
des Ratschbürtigen, eine dünne, durchlässige Haut, die
über andere Methoden der Abstoßung und Aufnahme verfügt
als die Normalhaut. Mit der Luft geht zum Beispiel ganz leicht die Wahrheit
durch sie hindurch, während Lügen ihr Filtersystem nicht passieren
können. Im Kampf mit der Lüge wird die Haut aber sehr beansprucht.
Daraus folgt, Pong lebt in einer Spezialhülle und muß aus Gefährlichkeitsgründen
den Abschluß gegen die übrigen Menschen suchen. Und er hat
seine Methoden, um sich die Menschen vom Leib zu halten.
Was aber folgt daraus in puncto Ahnen? Es folgt daraus, daß es Ahnen
im üblichen Sinn gar nicht gibt. Was gemeinhin als Ahnen bezeichnet
wird, ist im Gegenteil dazu verurteilt, durch hypnotisches Hinstarren
auf Pong die unbequemste Lage in seinem Grab anzunehmen. Je nach dem,
wohin Pong sich bewegt, ist dieses arme Gesterbs gezwungen, sich herumzuwerfen,
herumzudrehen, damit seine Augenhöhlen noch einen letzten Schimmer
von Pong auffangen. Das Gesindel labt sich an Pong, obwohl nicht zu ermitteln
ist, worin diese Labsal genau besteht. Vielleicht weil Pong so brandjung
ist, daß seine verhohlenen Strahlen selbst Aschen- und Knochenwesen
in ihrer Schüchternheit erglimmen lassen. Das kann aber nicht bewiesen
werden und wird vermutlich immer ein Geheimnis bleiben. Eines ist sicher:
diese Art Ahnen zählt nicht, weil Pong an ihnen nichts hat, sie aber
viel an ihm. Eine sehr einseitige Bedürftigkeit.
Anders liegt der Fall bei den übrigen Spezialpersonen des Großen
Ratsch; über die gesamte Menschheit verstreut sind es noch nicht
mal hundert. Von Ahnen zu sprechen wäre hier unangebracht. Ein Grosser-Ratsch-Mensch
geht nicht aus einem anderen Großen-Ratsch-Menschen hervor, sehr
wohl kann man aber von einer Brüdergemeinde im Geiste sprechen. Zur
Erläuterung sollen hier paar Brüder aufgezählt werden,
von denen er mitunter Rat und Aufheiterung empfängt:
Da gibt es Wezel Commerius, die Phönixschwinge. 1612 in die Welt
getreten zu Rotterdam. Ein kraftvoll in allen Sehnen und Muskeln modellierter
Mann. In seinen Augen das Lackschwarz von Käferrükken. Ein
großartiger Schlittschuhläufer, dessen Geist auch in versetzten
Zügen über die Welt hinfuhr, manchmal in eine übermütige
Kurve umbrechend. Von dessen eleganter Kraft ist etwas in seine Beine
geflossen, wofür er Wezel Commerius dankt.
Ferner Reinhold Ephraim Anz. Verweltlichung 1709 zu Carlsta. Unbescholtenes
Leben. Neun Eheanträge weggeschüttet, wie man saure Suppe wegschüttet.
Dafür reger Elektrisier-Austausch mit Katzen. Von Anz zu Pong ist
ein Funke übergesprungen, der bewirkt, daß ihn der Alltag nie
zuschäumt, daß ihm Einblicke gestattet sind wie keinem Menschen
sonst, daß er dünnen Boden gefahrlos überschleicht und
Fühlung mit der Welt durch ein gedachtes Schnurrhaar aufnimmt.
Sodann Ägipp, römischer Wagenlenker zur Zeit des Seneca. Von
ihm hat er gelernt, wie die fortstürmende Brust gelenkt werden muß,
damit der Karren mit seinen Gebeinen nicht am nächsten Prellstein
zerschellt.
Dann der Große Windelband, Potsdam 1802. Lockere dehnbare Ansichten
von der Welt. Dinge, die zu dünn sind oder zu spitz, alles Widrige,
Störende umwickelt und aus dem Blickfeld geschoben. Hatte nie einen
Schlüssel in der Tasche. Türen in gut geölter Aufhängung
erhalten, sie immer nur angelehnt und bei Bedarf mit zauberischen Fingerspitzen
aufgeschubst. Windelband und das Weib? Viele angetupft, in Häfen
aber nie eingelaufen. So auch Pong.
Schön und gut melden sich da von irgendwo her Zungen, die mit etwas
Leimigem beschmiert sind, wir wollen aber wissen, ob diese Herren gestorben
sind wie alle anderen. Ob sie verdarben. Oder wurde Todesverschonung über
sie verfügt? Oder hat man sie in jemand anderen zurückversenkt?
Zugenäht und fertig?
Er mag diese Frage nicht. Er wird sie nicht beantworten. Bitte eine andere
Frage.
Gehören dieser sonderbaren Bruderschaft nur Männer an?
Ja.
Aber zu ihrer Hervorbringung sind auch Frauen nötig?
Ja.
Geschieht es auf herkömmlichen Liebeswegen?
Er kann es nicht verneinen, will es aber auch nicht lauthals bejahen.
Frauen sind so wenig wirkliche Geschöpfe, daß selbst ein Mann
wie Pong, der sich darauf versteht, die Geheimnisse der Welt zu ergründen,
kaum je dahinterkommt, woraus sie gemacht sind. Am ehesten ist noch auf
die Methode Verlaß, den Wert der Frau in Mark und Pfennig zu bestimmen.
Da gibt es die Zweitausenddreihundertvierundzwanzig-Mark-Frau, der er
schon mehr als einmal begegnet ist, sogar die Dreihunderttausendundeine-Mark-Frau,
von der er annimmt, daß es sie gibt, ohne ihr je begegnet zu sein,
am unteren Ende der Skala die Zwanzig-Pfennig-Frau, wie sie sich zuhauf
in den Straßen herumtreibt. Die Eine-Million-Mark-Frau gibt es nach
Auffassung Pongs nicht, selbst Maria, Mutter Gottes, war allerhöchstens
eine Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig Mark-Frau,
und das nur, wenn man über gewisse Fehler, die im Johannes-Evangelium
mehr angedeutet als ausgeprochen werden, großzügig hinwegsieht.
Leider gibt man keine Ruhe, löchert ihn mit Fragen nach dieser und
jener Person, will wissen, ob die Aussicht gleich null sei, je eine passende
zu finden. Obwohl er versichert, daß er jetzt nicht den Kopf dafür
hat - draußen rauschen die Bäume, und er möchte über
ganz andere Sachen nachdenken -, wird man nicht müde, ihn mit Sätzen
zu quälen, die längst widerlegt sind.
Schade, sagen die Zungen, auch in einer Frau von bescheidenem Wert können
gewisse Talente schlummern, will er das etwa leugnen? So eine Frau fliegt
an den freien Arm des Mannes und geht mit ihm durch dick und dünn.
Sie verscheucht seine Sorgen - die Knopfsorge, die Nabelsorge und all
die anderen Sorgen, die mit seinen Pflichten in Verbindung stehen.
Er kennt seine Pflichten. Man braucht sie ihm nicht vorzusagen. Er betet
sie täglich wieder und wieder her.
Die Pflicht, seine Beine zu bewegen -
Gilt momentan nicht, weil er im Schlafanzug steckt.
Die Pflicht, zwischen dem Ein- und Ausatmen zwei Sekunden der Ruhe verstreichen
zu lassen -
Dazu braucht er keine Frau. Geatmet werden muß allein.
Die Pflicht, ein an der Jacke haftendes Haar zu entfernen -
Er gibt zu: Unter vorsichtiger Anleitung - vielleicht - eine Frauenaufgabe.
Die Pflicht, seine Zahnbürste mit dem Kopf nach unten über's
Wasserglas zu legen -
Mag sein, daß eine Frau auch das beherrscht. Aber wenn es an die
Schuhe geht, weiß die Kandidatin noch lange nicht, wie und wo die
Doppelschleifen sitzen müssen.
Die Pflicht, seine Börse verschlossen zu halten -
Die läßt er sich nicht nehmen und beantwortet sie mit der Pflicht,
sich zur Not eine Frau zu ersparen.