 |
|
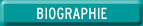 |
|
 |
|
![]()
![]()
Der Glückliche
Birgit Müller-Wieland
Hinter
der Dämmerung wartet der Morgen, feucht von Schweiß und zerfließenden
Träumen.
Wir streifen das Dunkle von unserer Haut, tappen hinaus in den Tag.
Wir behängen ihn mit mageren Wünschen.
Wir drehen unsere Köpfe und Herzen im Wind, wir werden sie nicht
los.
Ich
öffne die Augen. Helle Streifen zwängen sich durch die Spalten
der Jalousien. Nun knallt es und kracht, ist das ein Gewitter, nein, die
Müllabfuhr.
Ich stehe auf, schüttle mir die Gespenster der Nacht aus dem Kopf.
In der Küche steht Felix, die Pyjamahose hängt ihm um die Hüften.
Im fortwährenden Rülpsen und Fauchen stößt die Kaffeemaschine
Wasser in die Kanne.
Mein Sohn ist sprachlos und klug. Er schont seine Mutter durch unauffälliges
Verhalten. Er rührt in seinem Kakao, er starrt in das Heft vor sich,
in dem bunte Monster Weltraumschlachten schlagen und Blasen werfen.
Während meine eine Hand die dampfende Kaffeetasse zum Mund führt,
zuckt die andere kurz dorthin, wo sich helle Strähnen über der
Kinderstirn kreuzen. Meine Finger sind versucht, auch die schmale Nase
zu streifen, zu schmal für sein Alter, denke ich, und die Sommersprossen
auf den runden Wangen. Die Sommersprossen zählt er jeden Sommer,
sie vermehren sich stets.
Meine Hand findet zurück, sie will unser Abkommen nicht brechen.
Das Frühstück wird wortlos und ohne Berührung eingenommen.
In
der Dusche höre ich das Schnappen seiner Schultasche, noch ehe ich
mich abtrockne, steht er in der Tür.
Gleichgültig betrachtet er meine nasse Nacktheit. Früher mußte
ich ihm ausreden, daß ein Hase in meinem Bauch heranwächst,
ein Bär, eine Katze, ein Kind.
Mein Bauch ist so dick, weil du drinnen warst, lachte ich in sein skeptisches
Gesicht hinein.
Vielleicht ißt du auch zuviel Schokolade, sagte er, als er größer
wurde.
Ich steige aus der Dusche.
Aus deinem Busen geht die Luft aus, kam dann an einem anderen Morgen,
der fröhlicher war. Ich rannte ihm durch die ganze Wohnung nach und
rief - Luftsauger, ich kriege dich!
Fertig, sagt Felix. Mit seinem roten Fahrradhelm am Kopf gleicht er einem
der Weltraummännchen aus seinem Heft. Noch ehe ich HastdudeineJauseeingepackt
fragen kann, gähnt Felix, ich habs, ich habs.
Bis später, sage ich und wickle mich in ein Handtuch.
Auf jeden, sagt mein Sohn, dreht sich um und stapft den Abenteuern dieses
Tags entgegen.
Fall! rufe ich ihm nach.
Dann
muß ich lachen, weil ich mir alles einbilde.
Felix ist verschwunden, ich bin allein mit meinem Kopf und meinem Körper.
Ich stecke den Körper in eine ungeliebte Hose und ebensolche Bluse,
nachdem ich in den vollen Wäschekorb hineingeschaut habe. Den Kopf
stecke ich zwischen die Schultern, das sollst du nicht, da bekommst du
wieder Nackenweh, höre ich Felix sagen.
Es läutet.
Ich habe vergessen, daß Frau Annamaria heute kommt. Ausnahmsweise,
denn ab morgen bekommt sie Besuch.
Die
Kusine aus der Ukraine, singt Felix in meinem Ohr.
Ich kann mir Frau Annamaria nicht leisten. Irgendwann werde ich sie mit
dieser Wahrheit zum Fluchen bringen.
Guten Morgen, lächelt Frau Annamaria vor der Tür. Ich sehe in
ihr linkes Auge mit seinem warmen Schwarz. Vor ihrem rechten liegt ein
Schleier. Das verschleierte Auge steht schräg und fremd im Weiß.
Das ist lange her. Das war der Jähzorn meines Vaters, unterrichtete
sie mich beim Kennenlernen.
Der schlug mir mit einem Brett ins Gesicht. Da war innen ein Nagel dran.
Ich schließe die Tür.
Guten Morgen, Frau Annamaria, sie wissen ja, lächle ich zurück.
Sie schiebt ihren massigen Körper an mir vorbei. Er wird umspannt
von einem Kleid mit bunten Blüten auf schlammfarbenem Grund. Sie
streift mit geübten Blicken aus dem linken Auge die Unordnung und
öffnet die Tür zur Besenkammer. In zwei Stunden wird die Wohnung
nach Reinheit riechen.
Ich kann nicht mehr so gut wie früher, sagt Frau Annamaria.
Beim Bücken und Knien am Boden röchelt sie.
Ihr Körper erinnert sich zu gut an das Lager.
Ich weiß so vieles nicht mehr, sagt sie, aber mein Körper,
ja, der hat noch immer Hunger aus dem Kazett.
Ich klemme die Geldscheine unter die Vase am Tisch.
In zwei Stunden werde ich zurückkehren und die brauche ich, um genügend
leer zu sein im Kopf. Für das Kaffeetrinken, die Geschichten und
die Ratschläge.
Wenn Frau Annamaria geht, bleibe ich meistens noch am Tisch sitzen. Manchmal
gelingt es mir, an nichts zu denken. Dann starre ich eine Zeitlang auf
das Muster der Decke.
Manchmal möchte ich durch die Straßen der Stadt rennen, unter
ihren Baumkronen, durch ihre Bögen und Tore, an den gepflegten Friedhöfen
und eifrigen Menschen vorbei.
Dann
möchte ich eine Granate werfen.
Eine Granate möchte ich in die Stelle jagen, an der das Lager gewesen
war. Frau Annamaria wurde im Bauch ihrer Mutter in das Lager getragen.
Das war einige Tage, nachdem sich das Land ans Reich anschließen
ließ.
Gib nicht so an, höre ich in meinem Ohr.
Was erlaubst du dir, du miese kleine Kröte! fährt meine Stimme
hinterher. Erschrocken lausche ich ihr nach, wie sie sich im Raum verteilt.
Frau Annamarias breiter Rücken quillt aus der Besenkammer. Was haben
Sie gesagt, höre ich dumpf ihre Stimme.
Mühsam bewegt sie sich, dreht mir ihren roten Kopf zu.
Ich komme in zwei Stunden wieder, sage ich mit aufgebogenen Mundwinkeln.
Ist gut, ächzt sie, ich werde uns dann einen schönen Kaffee
aufstellen.
Draußen
sehe ich, daß die Sonne schon wieder müde geworden ist. Der
Himmel trägt grauen Schleier. Sein milchiges Licht bleicht die Stadt
aus. Wie immer stehe ich ein bißchen falsch vor der blanken Prächtigkeit,
in der die Gebäude und Plätze zugerichtet sind.
Ich habe mir diese Stadt ausgesucht, weil mir keine andere im Wege stand.
Sie sprühte mir ihre künstlichen Farben in die Augen.
Sie umgarnte mich mit großen Namen.
Die Namen standen auf den Plakaten im Sommer. Als Statistin hatte die
Stadt keine Verwendung für mich, so schluckte ich dieses und jenes.
Es war einmal, gähnt Felix in meinem Ohr.
Doch in Martins Mund hockte die Stadt mit vielstimmigen Versprechen.
Vielleicht hat er sich verändert, sagt Felix.
Ich überquere die Straße.
Wenn
wir schon keinen falschen Vater für mich finden, dann nehmen wir
doch den richtigen.
Ich schlendere an den Marktständen vorüber, hinter denen die
Bauersleute aus der Umgebung die Früchte ihrer Arbeit anpreisen.
Sie kommen einmal in der Woche von ihren Feldern, Gärten und Gehegen.
Ich weiß, wie die Erde sich anfühlt, wenn man in ihr kniet.
Ich kenne ihre Gerüche, das Hineingraben, das Herausreißen.
Das Pflücken kenne ich, das Hacken, das Köpfen, das Blühen,
das Blut.
Grüß Gott, sagt die Brotfrau, ihre rot verästelten Wangen
hüpfen auf und ab.
Hier, bei diesem Stand, hat Martin seinen Mantel um mich gelegt, der gehört
dir, er strahlte, wiegte und wärmte mich. Ungeteilt überließ
er mir später auch unser Kind.
Der Fleischhauer läßt sein Messer blitzen. Jetzt saust es in
ein Rückenteil. Rosaweiche Lappen gleiten auf das Brett.
Habe die Ehre, sagt nebenan der Blumenmann in seiner blauen Schürze.
Hier
hat mir Martin die erste Blume gekauft, sie duftete, natürlich.
Er hat sie mir an die Bluse geheftet.
Und seine weichen Lippen auf meinen vor Überraschung schiefen Mund.
Was ist denn jetzt schon wieder, sagt Felix.
Ich greife mir an die Brust.
Das Herz ist mir herausgehüpft. Irgendwo in dieser Geräuschwelt
schlägt es und braucht einige Zeit, bis ich es wieder zurückholen
kann.
Das kenn ich schon. Es steht ein Hohlraum da, mit Watte im Kopf und entrümpelter
Brust, Augen starren in die Vitrine, in der sich fein geädert Fleischstücke
stapeln.
Das Rest-Ich muß nur warten, gleich ist es vorbei.
Jesusmaria,
höre ich, es ist ein Bub, und dann ein Seufzen, das wie eine Drohung
klingt. Dann schließt sich eine Tür.
Während mir etwas Nasses und vom ins Lebengeratensein tief Erschöpftes
auf den Bauch gelegt wird, für das ich nur den Namen Mara vorbereitet
habe, heult meine Mutter draußen auf dem Krankenhausflur.
Also nicht Mara, die Bittere, wie ich kurz vor der Geburt aus dem Mund
Bibelkundiger erfahren habe, keine Tochter, mit der es leichter wäre
als mit einem Sohn. Der habe bessere Chancen, dem Vater nachzukommen,
dem Windhund, dem Lumpen, wenn ich den zwischen meine Finger kriege, knurrt
meine Mutter.
Felix. Diesen Namen stemme ich ihr einige Tage später entgegen, aus
meinem verschwitzten Bettzeug heraus, mit wüst entschlossenem Blick,
das ist doch kein Name, das arme Kind, schüttelt meine Mutter den
Kopf.
Und dann streckt sie ihre langen dünnen Arme aus, sie spitzt ihre
Lippen, sie hilft und summt und singt, und Felix schlüpft noch einmal
aus meinem Körper heraus, hin zu ihrem schon etwas verbrauchten,
aber durch Erfahrung und erfolgreiche Aufzucht mehrerer Kinder dem meinen
an Kräften weit überlegenen.
Ich nicke dankbar und kuhschwer und sinke zurück in die vergangene
Zeit, horche hinein in das Wachstum mit doppelten Herztönen, sehe
die Ausbuchtungen des fremden Wesens in meinem Bauch.
Meine Füße springen aus der Spur, die haben die anderen Frauen
der Familie gezogen. Von alten Bildern sehen sie mich an, mit Kindern
am Schoß, um die Hüften, vor den Füßen, in den Bäuchen.
Eine soll sogar gesungen haben beim Gebären, das ist die beliebteste
Geschichte.
Neben dem Feld fiel ihr das Kind aus dem Schoß. Dann hat sie sich
die Nabelschnur selbst durchgebissen, die Nachgeburt ins Schneuztuch gewickelt,
mit blutigen Zähnen hat sie das Kind unter den Baum gelegt und weitergearbeitet
bis zum Umfallen, sagt meine Mutter, ich bitte dich, sage ich.
Ich
muß sofort den Markt verlassen, seine Gerüche, Farben, die
Menschen, die schnatternd neben ihren Plastiksäcken gehen, ihren
Körben, in ihrem Donnerstagsgezwitscher, raus hier, raus.
Ich stoße an Ellbogen und Bäuche, jetzt bricht ein weißes
Feuer aus, eine blendende Helligkeit, die Sonne wirft sich auf alles,
als Rettung lockt der Park.
Du
weinst so viel, leg dich hin, das ist das Kindbett. Hätte ich nur
deine Milch, seufzt meine Mutter. Du bist zu nervös, schau, wie er
sich plagt. Laß dir doch helfen. Schau, das wird doch nichts.
Wie recht sie hat.
Es wird dann auch nichts aus der Natürlichkeit, der Mutterkindeinheit,
dem Kosen und Stillen, dem wohlverdienten Trost nach Monaten des Hinausbeugens
in eine Welt, in der Martin seine weichen Lippen ohne mich spazierenträgt.
6Wie recht sie hat.
Es wird nur eine scharlachrot entzündete Verzweiflung, ein Schwitzen,
Schreien und Hecheln, ein Kräfteschwinden, ein mühsames Gepumpe,
ein Versagensloch, in dem ich verschwinde, schlaf jetzt, ich kümmere
mich schon um ihn, wiegt mich die Mutterstimme ein.
Im
Dämmrigen, Moosigen schaukle ich nun, kühl ist die Luft. Was
unter der Sonne weiter geschieht, ich will es nicht wissen.
Jetzt setze ich mich auf eine Bank. Ein Hund mit schwarzem Zottelfell
hebt sein Bein, den möchte ich haben, sagt Felix.
Der
Hund säuft sein Spiegelbild aus einer Pfütze.
Ein Pfiff treibt ihn fort. Hunde folgen, wenn man sie ruft, das wird mich
immer wundern.
Ich mag Hunde lieber als Katzen, sagt Felix.
Katzen tun nie, was ich sage. Bei denen weiß ich nicht, ob sie froh
sind, daß man da ist.
Jahre
später wache ich auf, reibe mir die Augen, die dieses Mal nicht rot
werden vom Heulen, sondern vor Verwunderung.
Fünf und Zwei. Das ist der Blick zurück. Das sind die Zahlen,
in die ich mein Leben geklammert halte, festspanne wie auf einem Reißbrett.
Fünf Tage in der Stadt, im Büro, im Flüstern und Flattern
zwischen Summen, Stimmen aus blinkenden Bildschirmen, Telefonmuscheln,
nikotinentwöhnten Cheflippen.
Überstunden, Nachtstunden, Schlaf, mein Körper will Schlaf,
wie geht es Felix.
Er kann Oma sagen, sein erstes Wort. Meine Mutter gibt Wärmestrahlen
ab durchs Telefon, ist das nicht hinreißend.
Etwas reißt mich in eine Wattewelt zurück, in welcher sich
entkernte Wesen lächelnd und schwebend verständigen.
Danke, es geht mir gut, und am Freitag werfe ich ein paar Sachen in den
Koffer, am wichtigsten ist das Spielzeug, das ich in der Mittagspause
gekauft habe, werfe mich dem Koffer hinterher in den Zug, blicke auf meine
vorüberfliegende Herkunftslandschaft, die grün und fett wie
ein Algenteppich blüht.
Ruhig
ist es nun.
Zarte Haarsterne segeln vorbei, Kristalle aus Flaum.
Ich strecke Arme und Beine aus, He! schreit der Radfahrer, ein bunter
Strich.
Knapp, sagt Felix.
Ich greife mir an den Hals, schnaufe.
Schaue hinauf in die Blätter.
Die Lüfte fächeln die Last weg, die Unrast, sie wehen mir das
Herz zurück in den Leib.
Niemand
wartet am Bahnhof, der Kleine verträgt das Autofahren nicht.
Ich reiße die Türe auf, da steht Felix im Flur, an der Hand
seiner Oma, er wackelt vor und zurück, er blickt mich mit runden
Augen an.
Diese Augen drehen ab, fragen hinauf zum faltigen Gesicht, das wohlwollend
nickt.
Ich gehe in die Knie vor dem Kind, meine Wörter fallen in sein rundes
Gesicht, Unruhe spendend, eine Störung im Wachsen und Gedeihen.
Am Samstag hat sich Felix mit mir abgefunden, er flüchtet nicht dauernd
an den Omahals, er zeigt mir sein Spielzeug, am Samstagabend lacht er
mich an.
Zu Bett bringen läßt er sich nicht, er quengelt und weint,
nach einer Stunde hat er gewonnen, vielleicht beim nächsten Mal,
sagt die Oma und trägt meinen Sohn davon.
Häng die Wäsche nicht auf den Balkon, wir sind nicht bei den
Zigeunern.
Felix sieht dem Lumpen ähnlich, aber das wächst sich vielleicht
noch zusammen, du mußt tüchtig essen, sagt sie am Sonntag.
Sonst brichst du mir wieder zusammen vor Abschiedsschmerz.
Unter
dem lichtbefleckten Blätterdach dehne ich mich aus.
In meinem Körper haben sich die Organe wieder zurechtgerichtet, senden
ihre Geräusche.
Na endlich, sagt Felix.
Da vorne geht ein Mann, das könnte Martin sein. Aber nein.
Ich muß lachen. Martin ist ein überklebtes Bild. Eine monatliche
Zahl auf dem Kontoauszug.
Ein Fluch im Muttermund.
Der
Spiegel zeigt mir weiße Fäden. Sie wachsen aus meiner Kopfhaut,
sind stark und wellen sich.
Im Winter, wo man meinen könnte, alles sei hell und gründlich
verpackt, tun sich manchmal rote Flecken auf, kleine Schrecken für
das Auge.
Das ist der Blutschnee, sagt meine Mutter, alles hat seine Zeit, ich kenne
mich mit Unkraut aus.
Kannst du bitte Mama weiterüben mit ihm, frage ich, mein Blick bohrt
sich pfeilgerade dieser Bitte hinterher, in zwei Wochen kann er es vielleicht
schon, er lernt ja so schnell. Das Gesicht meiner Mutter zerfließt
ohne alle Vorsicht, das werden wir üben, gell Felix.
Im Flur presse ich mich an den weichen Kinderkörper, behauche eine
welke Wange, wende mich und rudere in das Leben hinüber, das übrig
bleibt.
Ein
Rauschen und Flirren ist über mir.
An diesen Bäumen baumeln viele Träume, von schräg unten
sehe ich es genau.
Die Leute flüchten ins Grün, sie erleichtern sich.
Sie hängen ihre Träume an die Bäume wie ausgesetzte Kinder,
die unaufhörlich plärrn.
Nachts
knarren die schweren Äste im Wind.
Luftkreisel umschmeicheln nun meinen Kopf. Zwischen Hellem und Dunklem
schwimme ich.
Auf den Haaren der Vorübergehenden tanzen Lichtperlen.
Am
Tag, als Felix gestohlen wird, kauert eine zusammengefallene Gestalt in
unserem Garten und rupft wie besessen.
Erdbrocken fliegen, brennendes und blühendes Grünzeug hinterher.
Sonst ist kein Zirpen zu hören, kein Rascheln, Brummen, die Natur
verhält sich ruhig. Ich bin durch das offene Gartentor gekommen,
stehe am Rasen und sehe dem Rupfen und Fliegen zu.
Plötzlich hört auch das auf.
Ist es die Luft, die mich zum Verharren zwingt, das Atemlose, das über
dem Garten schwebt?
Die Gestalt kniet in ihrem karierten Kittel. Sie kniet vornübergebeugt.
Ihre Hände sind schwarz.
Sie öffnet den Mund. Ihr Mund ist schwarz.
Der Himmel hängt tief.
Stille.
Sie ißt Erde.
Ich bin ein Gestrüpp. Ich bin eingewurzelt. In etwas Feuchtes, Festes.
Meine Haut hat die Farben der Büsche. Ich habe keinen Atem, keine
Gedanken, keine Zeit.
Sekunden vergehen, Stunden.
Ich sehe diesem gekrümmten Tierchen zu. Es spuckt und schluckt.
Ich höre das Knirschen. Splittern Zähne von Schneckenhäusern
ab? Wird Wurzelwerk zermalmt?
Dann rappelt sich das Tierchen hoch.
Es klopft sich die Erde vom Kittel. Es kriecht aus dem Beet heraus.
Meine Tarnfarbe hält.
Meine
Mutter wankt in Richtung Haus.
Erst jetzt fällt es mir auf.
Der Kinderwagen steht nicht vor der Tür.
Da schütteln sich die Arme. Da ruckt der Kopf. Da reiße ich
die Füße aus dem Boden und stürze ins Haus.
Meine Mutter finde ich im Bad, jetzt hat sie Schaum vorm Mund.
Die Zahnbürste fällt aus ihrer Hand.
Später
wachsen wir an den Schultern zusammen.
So sitzen wir bis kurz vor Mitternacht.
Die
Kirchturmuhr schlägt die volle Stunde in den Park hinein.
Frau Annamaria wartet, sagt Felix in meinem Ohr.
Ich stehe auf, gehe die Bäume entlang, trete aus der Schattenregion.
Lichtexplosion.
Augenblicklich wirft sich der Schweiß auf meine Haut. Ich schwanke
im Sonnenweiß, das mir die restlichen Stunden versengen wird.
Die Stadt ist diese Einstrahlung nicht gewöhnt. Sie ist für
silbrigen Regen bestimmt, Marionettenfäden.
Ich keuche. Die Luft siedet. Sieht jemand den Rauch über der Stadt,
die feine Asche?
Ich lehne an einer Hausmauer. Alles summt. Vom Himmel fahren die Katastrophen
durch Schüsseln und Antennen in die Wohnzimmer hinein. Die Luft läßt
sich atmen. Es wird doch wohl kein Atomkraftwerk hochgegangen sein.
Ruhig Blut, sagt Felix. Reg dich nicht so auf.
Ich biege um die Ecke.
Kleidungsstücke flattern schon von weitem als bunte Grüße
vom Balkon, Frau Annamaria hat gewaschen.
*
Kurz vor Mitternacht läutet das Telefon und Herr Viehböck von
der Gendamerie sagt, wir haben das Kind gefunden.
Es geht ihm gut.
Das ist ein schöner Traum, der immer wiederkehrt.
Felix schläft zugedeckt und bewacht in seinem Wagen, als wir kommen.
Aus der Ecke sieht uns ein Mädchen an.
Ihre Gesichtszüge sind auseinandergefallen.
Nur die Augen glühen geradeaus.
Sie ist vierzehn, sagt Herr Viehböck, ihr größter Wunsch
ist ein Kind.
Sein Gesicht rückt näher, seine Stimme wird leiser. Sie kommt
aus unklaren Verhältnissen, Sie verstehen.
Es ist uns egal, wo die Felixräuberin herkommt, ob vom Himmel oder
aus der Hölle.
Wir schieben unser Kind in unsere Welt zurück, die nun um einige
Fragen zugenommen hat.
Hinter die Fragezeichen setze ich Punkte. Es ist leichter, als ich es
mir vorgestellt habe.
Meine Angst schrumpft, sie rollt sich stachelig ein.
Meine Mutter wird auch weniger.
Sie nickt und verbirgt ihren Abschiedsblick vor mir.
Ich sehe zu Felix hin.
So greifen Zusammenwachsen und Auseinandergehen in eins.
Mit einem Lächeln wache ich auf.
Vor
der Türe höre ich sie singen.
Immer, wenn alles schön und sauber ist, singt Frau Annamaria ihre
Lieder mit einem Augenzwinkern.
...tappen hinaus in den Tag. Wir behängen ihn mit mageren Wünschen.
Wir drehen unsere Köpfe und Herzen im Wind, wir werden sie nicht
los...
Sie
übersetzte mir die Worte. Wir haben eine Sprache, die tropft wie
Honig, sagte sie, aber mit Pfeffer drin.
Ich ziehe meine Schuhe aus.
Nun höre ich ihr Summen, es ist dunkel und tief.
Wie die Erde meiner zweiten Heimat, erklärte mir Frau Annamaria.
Meine Mutter und ich sind übriggeblieben. Viele Lager haben unsere
Menschen geschluckt, auch den Vater. Wir sind nach Czernowitz gegangen,
nach dem Krieg, das war schwer, da suchten wir unsere Verwandten. Eine
Kusine war noch da. Einmal ging es uns gut und einmal schlecht. Meine
Mutter hat die Sprache nicht mehr lernen können. Die hat immer nach
unseren Bergen gejammert, den Seen. Fürs Umpflanzen war sie halt
zu alt.
Ich öffne die Tür.
Jesassmaria, sagt sie, wie schaun Sie denn aus.
Ich sehe ihr totes schiefes Auge. Ich sacke auf dem Sessel zusammen.
Da sind die Tropfen, sagt sie, gleich wird es besser.
Es ist so heiß, krächze ich.
Der Blick aus ihrem unverschleierten Auge wandert in meinem Gesicht herum.
Ja, sagt sie, und heut ist ja auch ein schlimmer Tag. Ich hätts auch
fast vergessen.
Sie legt das Putztuch auf den Tisch und verschwindet aus meinem Blickfeld.
Der Platz unter der Vase ist leer.
Gleich wird sie mit dem Kaffee zurückkommen. Dann wird es wieder
losgehen.
Das Leben hier. Vor dem Lager. Das Leben dort, in der Bukowina, nach dem
Lager. Die Fahrt in den Westen zurück.
Nach dem Sterben von Mutter, Reaktor und Sozialismus.
Drüben geht eine Schublade auf und zu. Nimmt Frau Annamaria jetzt
schon Geld, wenn ich da bin?
Ihr Schlurfen ist zu hören, sie kommt zurück.
Heut dürfen Sie nicht alleinbleiben, sagt sie.
Ihr Gesicht ist weich entstellt.
Ich starre sie an.
Sie hält ein Foto an sich gedrückt. Ich greife danach.
Auf dem letzten Foto, das ich von ihm habe, lacht Felix. Ich sehe einige
winzige Sommersprossen.
Auf der Rückseite steht in den krakeligen Buchstaben meiner Mutter:
Felix, April 1986.
Ich muß heute noch so viel erledigen.
Auch wenn jetzt die Sonnenarme nach mir greifen, da, durchs geputzte Fenster
hindurch. So viel Licht, das hält niemand aus, gleich werde ich die
Wohnung verdunkeln.
Und die Spiegel verhängen.
Ich werde die restlichen Ecken putzen, die Schuhe scheuern, nach Wind
haschen.
Die übriggebliebene Wäsche waschen.
Ich werde mir eine Liste machen.
Punkt eins bis zwölf.
Den Fernseher muß ich einschalten.
In der Dämmerung werde ich einen Hut aufsetzen, die Haut eincremen,
das Muttergrab besuchen, ein paar Narzissen pflanzen, ja, das ist nicht
schlecht, auf jeden, sagt Felix.
Fall, knurre ich, hör doch mal auf mit dieser Stummelsprache.
Die Wanduhr tickt.
Diese Uhr wird auch noch dran glauben müssen.
Ich richte mich auf.
Frau Annamaria, ich brauche Sie nicht mehr. Gehen Sie. Bittedanke.
Zitate der Rede im üblichen Rahmen sind möglich und honorarfrei. Die Verwendung von weiteren Ausschnitten müssen mit dem Verfasser, dem Tagungsbüro oder dem Piper-Verlag geklärt werden.
© 2000 ORF Landesstudio Kärnten.