 |
|
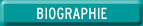 |
|
 |
|
![]()
![]()
Auszug aus L Ü C K
Ulrike Draesner
Eigentlich
war ich nie allein
Manchmal wurde ich weggesperrt. Doch selbst dann tauchte sie auf.
Und hockte sich vor mich hin. Und schaute mich an. Und grinste dazu.
Wie
die Senderwahl
in Mutters altem Küchenradio hakt der Sonnenstrahl über den
Fliesenboden des Bads, während sie, die ich bewache, einfach nur
vor mir sitzt. Wobei die gelben Fliesen wieder leuchten wie das, was sie
produzieren soll - dort, auf der erhöhten Plastikschale in Form einer
Mandoline, von derem grünen Rand ihr weißrosa Fleisch mir entgegenquillt.
Tier, sage ich.
Dass es draußen Morgen ist, und das Sonnenlicht schon drei Programme
weitergerückt; warum sie noch immer nicht leer wird, sage ich ihr.
Die Sonne kriecht. Auf meiner Haut, den nackten Armen, dem Millefleurs-Sommerkleid.
Die Blätter der drei großen Bäume vorm Badfenster drehen
in der Luft. Dass ich nicht nach draußen sehen soll, antwortet sie,
dass ich dableiben muß, solange sie nicht fertig ist.
...muß abgewischt werden, ruft Mutter von unten.
Die Blätter drehen wie Kiesel. Meine Augen drehen mit. Ich blinzele.
Wende den Kopf hierhin und dorthin - komme nicht raus - sehe Dinge - ruckartig
- unzusammenhängend - ihre nackten Waden, ihre runden, weichen Knie.
Sie sind riesig, in diesem Licht, haben Grübchen, Dellen; ein überall
fleischfarbenes, mit wachsiger Haut überzogenes Gesicht.
Tier, denke ich.
Da kräht unter dem süßen gelben Wuschelkopf der feuchte
Mund: fertig fertig - und ich hebe Anita vom Topf.
Ich
weiß, du meinst das nicht so,
sagt Mutter oft. So oft wie: wir vier. Sie schüttelt dazu den Kopf,
daß Hennarot in ihren Locken spielt. Weder Farbe noch Locken sind
echt, aber das wissen nur wir. Wir sind vier, "wir vier", das
reimt sich fast.
- Anita stinkt.
- Ich weiß, du meinst das nicht so.
- Doch.
- Nein, nein, niemals stinkt sie so, du kannst es bloß nicht anders
sagen.
- Natürlich kann ich.
- Nein. Wenn sie wirklich so stinken würde, müßtest du
das nicht machen, das wäre doch schrecklich.
Das finde ich auch. Irgend etwas ist also falsch: meine Mutter oder meine
Nase. Eine lügt. Ich entscheide mich für meine Nase. Also gegen
meine Nase. Ich bin verwirrt. Mutter, entscheide ich, lügt mich nicht
an. Wir zwei, sagt sie manchmal zu mir. Ich drücke meine Nase dann
an Mutters Bauch. Mutter drückt mich dann an sich. Meine Nase und
Mutter sind eins. Niemand lügt. Der Dreimaster auf der von mir gemalten
Kachel, die Vater über der Wanne zwischen all dem Fliesengelb eingemörtelt
hat, fährt durch ein glänzendes schwarzschaumiges Meer. Vor
dem Schiff treiben drei kleine Gespenster im Wasser. Sie wedeln mit den
Armen. Mein Magen knurrt. Ich will weg. Anita schreit, weil sie doch nicht
fertig ist.
Wir
leben im Kiesgebiet,
auf rundgeschliffenem, graublauem oder graugrünem Stein. Restmulde
aus dem Eem. Vater sagt, alle Menschen leben auf etwas aus der Vergangenheit.
Wer Auslauf braucht, kann in die stillgelegte Kiesgrube auf der anderen
Seite des Flusses gehen. In ihn steigt man ohne Problem zweimal hinein,
denn er fließt in einer Schleife, um das Sägewerk anzutreiben.
Unter jedem Tritt klickern die Kiesel weg. Die ganze Umgebung, das sogenannte
Umland, Industriegebiet rundum - flach wie Hähnchenbrust. Zwischen
den aufgeschütteten Kiesresten wächst der Sauerampfer, den Jola
am liebsten ißt. Außer Jola mag ich noch Hunde. Manchmal schießt
einer in der Kiesgrube hinter einem Steinhaufen hervor, weg vom eigenen
Gestank. Mit Jola kann ich im Gebüsch sitzen, Schokolade essen, Anita
zerstören.
Denn Jola und ich sind schnell. Wie weich biegen unsere Körper sich
beim Gummitwist, erregend, wie gleitet die Haut über den Knöcheln,
rosabraun, wie blitzt hellster Härchenflaum, ja, unsere Muskeln spannen
sich, Federn sind wir - aber aus Draht, unsere Knie immer zerschlagen,
wir stoßen ins Leben vor.
Und dann kommt Anita. Hängt sich dran. Will mit. Dabei sitzt sie
ewig auf dem Topf, redet noch immer unverständlich, mit 4, wie ein
Baby watschelt sie hinter uns her. Jola und ich, ins Gebüsch. Das
grünliche Licht dort, der modrige Duft, das Moos, das wir ausgelegt
haben, damit es die Geräusche schluckt, die Enge, der kugelige Raum,
das alles sagt: hier hört die Unschuld auf. Die dornigen Zweige,
die wir an den Eingang halten, sagen es auch. Gestern hatten wir ein Fernglas
dabei. _Feldstecher> nennt Vater es. Ich schob die großen schwarzen
Augen zwischen den dornigen Zweigen aus der Höhle. Anita lief schreiend
davon. Jola nahm das Fernglas, drehte es um, gab es mir. Ich lachte, denn
wie klein war Anita, wie torkelte sie doch, wie weit weg stand sie schon,
ein schwammiger Fleck: meine Schwester. Ausradiert. Ja, mit solchen Augen,
schwarzen, großen, runden, schauen wir manchmal aus der Höhle
heraus.
- Seid ihr endlich fertig?, ruft Mutter am Treppenaufgang.
Ich starre auf die Bäume über dem Walmdach, unter dem Jola noch
träumt. Scharf und klar treten die Stämme gegen die Morgensonne
heraus. Anitas blaue Augen blitzen mich von der Seite an. Der Plastikboden
der Mandoline knirscht, rutscht mit knirschendem Schaben über die
Fliesen. Ich greife zu, fasse einen Zipfel von Anitas Rock. Fühlt
sich an wie mein Rock, weil er mal meiner war. Anita fällt. Bevor
sie wieder schreien kann, schiebe ich ihr einen Gummibär in den Mund.
Das machen wir jedesmal. Ich habe das Bärchen die ganze Zeit in der
Hand gehabt. Es ist klebrig und warm von mir, doch das stört Anita
nicht. Sie kaut, und ich sehe ihr an, dass sie noch eines wollen wird.
Das macht sie jedesmal. Ich habe einen geheimen Vorrat. Sie kennt ihn
genau.
Seit
Anita da ist,
bin ich ihre Bewacherin. Mutter bewacht mein Bewachen Anitas. Damit ist
Mutter so beschäftigt, dass Vater sie, Mutter, nicht mehr zu bewachen
braucht. Nur früher sind Fehler im Bewachen passiert. Die Sache mit
dem Neger - zum Beispiel. "Die Sache". Ich darf das nicht wissen.
Aber Erika hat es gestern erzählt.
Erika besucht Mutter jeden Mittwoch. Plausch. Sie fährt mit ihrem
roten Fahrrad über den kiesigen Weg, der auch ein holpriger Weg ist,
zu uns. Jeden Mittwoch kommt Vater später heim. Später als dienstags
oder donnerstags. Mittwoch, ein geschäftiger Tag, sagt Vater. Erika,
seine ältere Schwester, ist Lehrerin. Sie hat viele Kinder, sagt
sie. Für sie ist Mittwoch ein Tag wie Dienstag oder Donnerstag. Erikas
Haare sind grau. Ich habe Angst, so zu werden wie sie.
Mutter und Erika schauen die Schachteln an. Die Schachteln stehen nebeneinander.
In einer liegt ein Büschel meiner Haare, als ich 6 Monate war, eines
mit 12 Monaten, 18 Monaten, 2 Jahren, zweieinhalb, 3, 4, 6, 8 Jahren und
eines, ganz neu. Dazu Milchzähne. In der anderen Schachtel liegen
die Haare von Anita. Da hören die Bündel bei Nr. 6 schon auf.
Und kein Milchzahn, kein einziger, keiner! Ich bin froh um die Schachteln,
denn da gewinne ich.
Ihr liegt dort wie kleine Tote, sagt Erika, Zähne und Haare, die
bewahrt man doch nur von Toten auf. Dabei schaut sie Mutter an, die diese
Schachteln auf ihrem Schreibtisch aufbewahrt. Erika hat keine solchen
Schachteln, sagt Mutter, sie sei nur neidisch, Erika, die wolle ein Kind,
sagt Mutter, aber wer weiß, ob sie, Erika, überhaupt eine geeignete
Schachtel hat.
Und da hat Erika gestern beim Mustern der Fotoalben, das dem Mustern der
Schachteln immer folgt, Mutter nach dem Neger und nach Fotos des Negers
mit Mutter gefragt. Diese Sache damals!, hat Erika gesagt. Der Neger war
Mutters Freund. Damals, im Dorf. Nach dem Krieg, als auch Tante Erika
plötzlich im Dorf wohnte. Mit Vater. Der erst 15 war. Also noch zu
jung. Während Mutter schon 20. Also gerade im rechten Negeralter,
sagte Erika. Dabei blitzten ihre Augen Mutter an, wie Anita mich eben
angeblitzt hat. Mutter wurde rot. Ich sagte nichts. Ein Neger hätte
mir gefallen. Ich hatte schon ein paar Neger in der U-Bahn gesehen. Die
U-Bahn war ganz neu, und die Neger sahen auch ganz neu aus, so glänzend,
so poliert. Ich mochte klare Farben. Schwarz war gut, nur rot noch besser.
Die roten Flecken auf Mutters Wangen schaute ich genau an. Sie verschwanden
leider sehr schnell. Mutter nämlich fragte Erika zurück: und
wie war es bei dir? Biss da jemals jemand an?
Erika wurde blasser. Meist war sie sowieso schon blaß. Das kam vom
Puder auf ihrem Gesicht. Zu Begrüßung und Abschied mußte
ich den Puder küssen. Erika stieg von ihrem roten Fahrrad, mit dem
sie den holprigen Weg fuhr, zog die Plastikklammern aus ihrer Hose. Küssen.
Beim Abschied umgekehrt: Küssen. Dann schob Erika die Plastikklammern
in die Hosenbeine, stieg aufs Rad und fuhr den holprigen Weg, der auch
ein steiniger Weg war, zurück zu ihren Tagen, in denen ein Dienstag
wie ein Mittwoch oder Donnerstag aussah und es keine Neger gab.
Anitas
Füße schleifen am Boden,
auf der Treppe riecht es nach Kaffee. Die Küchentür schiebt
sich in meinen Blick, denn ich habe den Kopf zur Seite gedreht, weg von
Anita, die sich an meine Schulter schmiegt und das Gummibärchen kaut.
Marmelade gibt es, sagt die Kartenkönigin zu Alice, `jeden anderenA
Tag. So wird das Glück verteilt. Marmelade gibt es also nie.
Ich trage Anita die Treppe hinunter, obwohl sie längst laufen kann.
Aber wenn sie mich oben am Absatz ansieht, die Arme nach mir ausstreckt
und schleckt: wie gut ist doch dein Gummibär, dann schleppe ich sie
eben wieder, obwohl Mutter sagt, die ist doch viel zu groß für
dich!
Klemme mich zwischen Tischkante und Besenschrank auf einen Stuhl. Der
Heizkörper rauscht. Jetzt, Ende September. Die Eiszeit kann so weit
entfernt nicht sein. Was Eem wohl heißt? Muß ich Vater fragen,
doch er ist mal wieder nicht da.
Sonst sind wir immer zu viele. Immer heißt es dort, wo ich hinkomme:
oj, noch eine!A Im Kindergarten fing es schon an. Ich bekam keinen Platz.
Bei der Einschulung mußten sie extra Stühle und Tische aus
anderen Klassenzimmern holen; wir waren noch mehr als gedacht. Doch hier,
in der Küche, sind wir zu viele und zu wenige zugleich. Wir vier.
Vater fehlt, und Anita ist ein Kropf.
Mutter schaut in die Zeitung. Ich schlürfe den inzwischen lauwarmen
Kakao. Vater bewacht Supermarktbauten, "schaukelt die Chose".
Supermarktbauen geht einfach, sagt Mutter, dass das doch jeder. Weder
Keller noch Speicher noch Balkon. Wozu man ihn da überhaupt brauche!
Aber Vater zieht die linke Augenbraue hoch - die, die sich gern allein
bewegt: dass er seine Pappenheimer kennt! Immer, wenn er die Baustelle
betritt, essen die Bauarbeiter oder trinken Bier oder tun beides. Meistens
trinken sie ein Bier und einen Schnaps. Vater, als alter Fuchs, schleicht
sich zwischen den Betonverschalungen an. Einmal versuchte ein Maurer,
der Vater trotz der füchsischen Tarnung kommen sah, sein Bier zu
retten - schüttete es in seinen Bauhelm. Vater hat es genau beobachtet,
nur gesagt hat er nichts, ein bißchen mit den Arbeitern geredet
wie immer, im Harmlosjargon, und dann: so, jetzt aber los! Alle setzten
sich den Helm auf, eben der Missetäter auch, was blieb ihm schon
übrig.
Das erzählt Vater aber nur, wenn Mutter nicht zuhört. Was bringst
du nur die Kinder wieder auf Ideen, würde sie sagen. Dabei hat sie
selbst schon die Idee gehabt, mir Bier übers Haar zu kippen, damit
es blonder wird. Bei ihr hat man es früher auch so gemacht, zumindest
vor dem Krieg, als es Bier noch in rauhen Mengen gab.
Ob der Bauarbeiter blonde Haare hatte, frage ich Vater lieber nicht. Wir
verstehen sowieso alle nichts davon, wie schwer es ist, ohne Sprache gerade
Wände zu bauen. Denn die Arbeiter reden nur ausländisch, und
Vater redet nur, eigens für sie lauter, deutsch. Allerdings ist es
ganz ohne Sprache noch immer leichter, gerade Wände zu bauen als
mit Sprache, sagt Vater. Er kommt, das ist jetzt ein Vorteil, schon immer
mit wenig Sprache aus.
Ich trinke den Rest meines Kakaos. Da Vater nicht da ist, ist Mutters
Frühstück von Anfang an ein gemütlicher Teil. Wir-vier.
Während ich Anita im Bad bewache, und Vater die Bauarbeiter bewacht,
bewacht Mutter mein Bewachen Anitas, die die Gummibärchen bewacht.
Der Neger war ganz jung. Und schön. Vater hatte es dann auch irgendwann
mitbekommen. Er sprach nie davon. Die Neger, sagte er immer, wenn er von
Negern sprach. Neger kamen nur in der Mehrzahl vor, bei Vater. Bei Mutter
in der Einzahl. Nur dieser Neger hatte ihr gefallen, sonst keiner. Die
Neger, sagte Vater, wenn er mittwochs nach Hause kam und Erika saß
da und schaute unschuldig nach Südafrika, neben Vater, im Fernsehen,
die schlagen sich alle nochmal gegenseitig tot. Mutter war schwanger geworden.
Hatte eine Abtreibung gehabt. Ich verstand, was Erika erzählte, denn
Jola und ich hatten die Bravo und Jola hatte Was Mädchen mit 12 alles
wissen wollen. Wir waren 9 und wollten daher noch viel mehr all das wissen,
was man auch mit 12 nicht weiß. Mutter hatte ein Kind abgetrieben,
das sowohl von dem Neger als auch von Vater hätte sein können.
Im Dorf, mit der Stricknadel. Die vorher abgeglüht wurde. Das Kind
war noch so klein, dass man die Hautfarbe sowieso nicht gesehen hätte.
Auch wenn es mit der Stricknadel aufgespießt wurde. Ob Vater das
mit dem Kind wußte, wußte ich nicht. Dass ich es wußte,
wußte auch niemand, weil niemand wußte, dass in Wohnzimmerwände
Ohren eingebaut werden, die aussehen wie meine Ohren und nicht aus Pappe
sind.
Hast du wirklich alles weggeschüttet?
Diese Frage läßt Mutter an keinem Tag aus.
- War es zu weich?
- Hat es fädig ausgesehen?
Mutter schaut mich mit den Zeitungsaugen an, sekundenlang leeren sie die
Buchstaben, die sie eben gelesen haben, auf mir aus, dann sehen sie mich
und Mutter fällt ein, wozu man mich, außer zum Bewachen, noch
gebrauchen kann:
- Nach der Schule gehst du bei Schlinke vorbei und holst die Urlaubsfotos
ab.
Anita hat noch etwas von ihrem Kakao. Immer, wenn ich schon fertig bin,
schmatzt sie extra laut und schaut mich über ihren Tassenrand hinweg
listig an. Darauf könnte ich gut verzichten. Aber sie sitzt mir gegenüber
und ist nicht zu übersehen. Schon ihrer Haare wegen nicht. Selbst
hier in der Küche, in die das Licht nur gebrochen fällt, weil
sie nach Norden schaut, die Küche, wie Mutter sagt, selbst hier leuchten
Anitas Haare kräftig blond. Während meine unentschieden aschblond
sind, wie Mutter sagt, graublond, schon jetzt, mit 9. Da leuchtet nichts.
Und auf den Fotos ist es am schlimmsten.
Immer darf Anita, als die jüngere, vor mir stehen. Immer verdeckt
ihr sonniger Körper meinen, denn sie ist kaum kleiner. Und ihr Haarglanz
strahlt nicht auf mich ab, sondern über mich hinweg. Solche Pracht
reißt Mutter zu Rufen des Entzückens hin. Sie freut sich gleich
doppelt, denn Anita ist ihr Produkt, das Foto ist ihr Produkt, und beides
ist schön.
Mein Teller ist leer. Lück, sage ich mir, das gefällt uns nicht.
Die Blätter der Jolabäume werfen kleine schwarze Schattenflecken
auf Anitas jetzt beinahe rötlich glänzendes Haar. Ich greife
nach noch einem Toast. Butter. Erdbeermarmelade. Mein dritter Toast. Zwei
sind erlaubt. Starre auf meine zerschrammten Knie. Anitas Fell schimmert
so schön, würde es gern vor meinem Bett auslegen, drauftreten
jeden Tag.
Ein Foto gibt es, auf dem man von mir mehr als von Anita sieht.
Lück, sage ich mir, das gefällt uns gut, da stehe ich vor Anitas
Kinderwagen und schaue sie an.
Und sie mich.
Und ich sie.
Diesmal hilft Anita ihr Haar nicht, weil sie eine Mütze trägt.
Dabei ist es Sommer. Ich nämlich trage ein helles, kariertes Kleid.
Das ganz kurz ist. Man sieht meine nackten Beine. Man sieht meine Unterhose,
klein und weiß, unter dem Kleid. Damals war ich 5. Anita und der
Kinderwagen nehmen viel mehr Platz ein als ich. Trotzdem sehe ich hübscher
aus. Der Rand des Unterhöschens blitzt. Nur den Rand des Fotos hat
Mutter nicht hinbekommen. Auf der rechten Seite ist selbst hinter Anitas
Wagen noch Platz. Doch bei mir hat Mutter einen Teil des Pos abgeschnitten,
über den sich das Kleidchen wölbte und lupfte. Und wie! Lupfte,
wölbte. Das konnte ich schon mit 4.
- Jetzt aber los!
Schulen rufen so laut, dass Mütter es durch einen ganzen Ort hindurch
hören. In der Tür, den Ranzen an einem seiner roten Lederriemen
über der Schulter, drehe ich mich noch einmal um. Der Frühstückstisch
biegt sich mir entgegen, der Toast duftet, an meinem Platz steht noch
das Marmeladetöpfchen mit den lila Hähnen, das ich so mag, die
Butter sieht auf ihrer Schale aus wie ein kleiner Fisch - da gleitet der
blaue Fußboden nur so unter mir weg.
- Knall die Tür nicht so zu...,
da knallt es schon; schon bin ich fort.
Scharfe Kanten, knirschendes Laub. Mein Schatten geht lang und wippend
neben mir; wie ein Buckel sitzt der Ranzen auf ihm. An der Ecke zur Hauptstraße
steht Jola. Jeden Morgen. Hier machen wir unseren Deal.
Silberpapier
raschelt,
glatt streicht es sich auf der Schulbank aus. Tausche Großmutters
Nimm2 gegen Schokostückchen. Die Nimm2 kommen aus Großmutters
Großmuttertasche in meine Hand, wie von selbst. Die Handtasche riecht
nach Puder und Staub. Großmutters Gesicht riecht nach Handtasche.
Die Bonbons riechen nach dem Gesicht. Ich würde sie nie essen. Doch
Jörg ist verrückt nach Nimm2. Jola tauscht eines gegen eine
ganze Rippe Noisette. Gibt es Jörg, gegen einen Kuss. Jola ist verrückt
auf Jörg. Der Deal klappt. Ich sauge meine Backen über der Schokolade
nach innen und stelle mir die Küsse vor.
Außen sehe ich wie eine kleine Weide aus, hat Vater am Sonntag gesagt.
Ich stand an seinem Fischbecken und hatte mir das Aschgraublond wie jetzt
übers Gesicht gehängt. Hinter meinem Haar, das auf den Schokopapierteich
meiner Bank fällt, kaue ich unbemerkt. Hebe ich die Hand, funkelt
das Alupapier.
Wir sind viele, ich spüre die anderen, ganz nah. Doch was habe ich
mit ihnen zu tun? Schmelze in meinen Silberteich. Schon bin ich fort.
So sind wir alle. Ich verstecke mich in der Menge. Denn eine Frage der
Lehrerin saust im Klassenzimmer herum, ein heißer Pfeil, er sucht
ein Ziel.
Innen bin ich keine Weide, sondern ganz mit Blut gefüllt. Mein Blut
ist rot wie Dieters Haar, rot. Manchmal will mein Blut aus mir heraus.
Bei den anderen ist es gut versteckt; ich weiß nicht, ob sie wirklich
so gefüllt sind wie ich. Nur bei mir weiß ich es sicher, denn
mein Blut versteckt sich schlecht. Es sitzt knapp unter der Haut, an den
Händen vor allem. Manchmal will es auch zum Hals heraus, besonders
wenn ich sprechen muß. Dann flamme ich, wie Dieters Haar.
Ich kann mir Mutter vorstellen, mit dem Küssen beim Neger. Mit dem
Küssen bei Vater nicht. Vater ist neidisch auf die Neger. Denn Vater
hat eine Glatze, und sie wächst. Als ich am Teich stand, und er vor
mir kniete, sah ich sie. Einem Neger mit Glatze bin ich noch nie begegnet.
Ich kann mir Küssen vorstellen, mit Dieter.
Das Klassenzimmer dreht sich nur um ihn. Kein Wunder, dass die Frage der
Lehrerin es auch schon merkt:
- OMO!
Es ist nicht sicher, ob _Omo> ein richtiges Wort ist. Ich habe Omo
geschrien, jetzt bin ich selbst überrascht. Denn Dieter hat keine
Antwort gewußt. Da klingelt es. Überlegt bis morgen einen besseren
Reim auf Limo, ruft Frau Bartel uns nach. Die Silberkette um ihren Hals
funkelt wie das Schokopapier auf meiner Bank. Ich sehe es genau, denn
Frau Bartel hält mich fest und erklärt mir, warum man nicht
zwischenrufen darf. Ihre Locken erinnern mich an Mutters, dicke Wicklersträhnen
ineinandertoupiert.
Ja, sage ich.
Und dass man während des Unterrichts nicht essen darf und ich nicht
soviel Werbung schauen soll, wobei ich nicht nur Werbung im Fernsehen
sehe, sondern auch den Mond. Der jetzt von Menschen betreten worden ist,
amerikanischen Menschen, die uns nah sind, hat Vater gesagt; die Erde
ist blau, habe ich gesehen, leuchtend hing sie da, schön-strahlend-schräg
im Nichts, und die Omo-Werbung kam danach.
Ja, sage ich, ja, und sause hinaus. Die Sonne macht Lichtflecken auf den
Pausenhof. Ich trete hinein, damit mich keiner berührt. Lappige Gemüsealgen,
zerflossen, schal, stehen ein paar Lehrer herum, vor Hitze die Augen halb
geschlossen. Limo ist ein richtiges Wort und ein reales Getränk,
der Pausenhof ist voll davon. Ich bin schnell, bin schon hindurch; vor
Limo ekelt mir, schmeckt wie zu warmer Gummibär.
Meine Haut leuchtet, das ist nicht schön. Eine Allergie, geht schon
vorbei. Ich habe eine Idee gehabt, nicht nur Omo. Nein, eine Idee für
Anita, ganz speziell. Was für ein wunderbarer Tag! Davon leuchte
ich, doch leider sieht man in diesem Leuchten auch die roten Punkte auf
meiner Haut besonders gut. Ich schleudere den Ranzen in Mutters geputzten
Flur, schreie Hallo!, greife mir Teddy und sause in den Keller, wie nichts.
Die Muffigkeit des Vorratskellers rechts, der Zigarettenrauch aus Vaters
Büro, ganz hinten, am Ende des Ganges links, durchsetzt mit Waschmaschinendampf.
Ich gleite in die Dunkelheit der Waschküche, ein kleiner Kern in
der trüben Hohlheit des Hauses. Die Maschine läuft. Das tröstet
mich. Denn Dieter hat mir im Pausenhof hinterhergewunken - doch ich bin
weitergerannt. Starre auf die nasse, durchwalkte Wäsche, starre auf
die Schaumschlieren am Bullaugenglas. Ein großartiger Tag, ein beschissener
Tag!
In der Ecke der Waschküche liegt ein riesiger blauer Ball. Jetzt,
im Halbdunkel, ist er schwarzgrau. Ich weiß, dass er in Wirklichkeit
blau ist. In Wirklichkeit, also im Licht. Ich aber, und auch der Ball,
sitzen im Dunkeln. Auf einem der wenigen Fotos, die Mutter vor Anitas
Geburt machte, versuche ich, diesen Ball hochzuheben. Er ist nur knapp
kleiner als mein Körper. Ein gute Zeit, damals. Hierin bin ich einer
Meinung mit Großmutter, die damals immer "die gute Zeit"
nennt. Doch obwohl es die gute Zeit war, spielt der Ball auf dem Foto
Anita. Er verdeckt mich. Nur der oberste Rand meiner Haare ist zu sehen.
Und meine Hände. Sehr klein und sehr weiß greifen sie, wie
zwei Gespenster, um das Meer des blauen Balls.
Die Sache mit Dieter war so großartig angelaufen. Aber nun ist Dieter
weg. Da ist nur die Idee für Anita: die tunk ich rein! Ich ziehe
ein Stück von der Lakritze ab, die Jola eben mit mir tauschte, Sonderdeal.
Eine ganze Rolle Lakritz. Lang und schwarz, fast so gut wie Schokolade.
Ich schließe die Augen. Schlecke daran. Besser als Schokolade, denn
lang und rot stelle ich mir die Lakritze vor, kurz stecke ich auch Teddy
etwas hin, damit er ruhig ist, und dann - dann mache ich die Augen ganz
fest zu, mache den Mund ganz weit auf, schiebe mir die Lakritze über
die feuchten Lippen und beginne zu lutschen - an dem süßen,
nie endenden Dieter-Haar.
Tunken
Von Vater habe ich gelernt: mit kleinen Hunden, die in die Wohnung pissen,
macht man es so.
Ich mache das Geräusch. Spitze den Mund, drücke meine neuen,
viel zu großen Schneidezähne in die Unterlippe, sauge Luft
an. Die Lippen machen dieselbe Bewegung wie Großmutter, wenn sie
Nudeln ißt, die sie italienisch, zu lang, unmöglich findet.
Dabei spricht sie von tunken und stippen, Stepke und Kraut, das bei ihr
rot ist statt blau. Diese Großmutter-Wörter benutzt Mutter
nie, auch die Geste mit den Lippen braucht sie nicht. Ich aber tunke und
stippe, und Anita schaut zu.
- Warum warst du nicht bei Schlinke?
- Keine Zeit.
- Dafür frißt du jetzt wie zwei.
Stimmt. Ich rolle die Pfannkuchen mit Marmelade ein. Es riecht gut. Ich
arbeite schwer. Die Marmelade tropft beim Abbeißen auf den Teller,
auf mein Kinn. Brombeer, dunkel und süß. Ich lache und mache
das Geräusch. Blinzele Anita quer über den Tisch zu. Das Geräusch
kündigt Gummibärchen an.
Es ist ein Spiel ums Glück.
Morgens schmeckt das Glück wie ein Gummibär und sieht auch wie
einer aus. Mittags ist es anders. Meine Idee!
Anita versteht nichts vom Glück, sie hat es einfach, doch jetzt ist
mittags, und was Anita hat, ist eine Ahnung, die fehlt.
- Ich nehme Anita mit hoch.
Mutter ist froh, Eintracht zwischen den Kindern, gemütlicher Teil.
Der Millefleursfleck geht die Treppe hinauf, Anita stapft von selbst hinterher.
Das Licht im Bad sieht grün aus, die Hähne spiegeln, Mutter
hat auch hier geputzt. Ich deute auf meine Tasche:
- Da. Aber erst du.
Und knöpfe Anita die Latzhose auf. Und sie hockt sich hin.
- Wird's?
Das Schiff schwimmt auf seiner Kachel, die kleinen Figuren treiben im
Meer. Mein Plan ist einfach. Kräftig spritzt der Strahl auf den Boden
der Mandoline. Anita lacht. Schmeckt schon den Gummibär. Als sie
aufsteht, packe ich sie am Hals. Sie schreit nicht, sieht mich nur erstaunt
an, ich bin aber auch vorsichtig, mache noch einmal das verlockende Geräusch.
Schau mal. Halte die Luft an, schaue selbst in ihren Topf, beuge mich
darüber, Anitas Kopf kommt hinterher, ich reiße sie mit beiden
Händen vor, packe sie am Hals, von der Seite, von hinten, halte sie
gepackt, tunke sie rein. Das Licht klumpt zusammen, in meinen Fingern,
die in ihre Locken greifen, gelb auch die Luft, wie die Fliesen, alles
schwappt. Höre es rasseln, wenn ich atme, als atmete ich Fliesenscherben
ein, laut stoßen sie in mir aneinander, stoßen mich an, als
lache jemand in mir - jemand aus der Zukunft, tönern, unberührt.
Mit beiden Händen greife ich zu.
Ich drücke, sie drückt dagegen, etwas gibt nach, rutscht weg.
Mutter stürmt ins Bad, Anita hockt schreiend neben ihrem Topf, ganz
sauber, abgewischt.
- Was weiß ich, was sie hat, sage ich.
Zitate der Rede im üblichen Rahmen sind möglich und honorarfrei. Die Verwendung von weiteren Ausschnitten müssen mit dem Verfasser, dem Tagungsbüro oder dem Piper-Verlag geklärt werden.
© 2000 ORF Landesstudio Kärnten.
t