 |
|
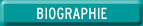 |
|
 |
|
![]()
![]()
-
Hallo. Die Hand des Kondukteurs rüttelt zaghaft an Pavlos' Schulter.
- Billets vorweisen, bitte.
Dieser taucht auf aus dem bleiernen Teich, in den er hineingegossen scheint,
und er öffnet die Augen. Ein Kribbeln streift sein Gesicht, als wolle
es erröten. Er rappelt sich auf und sagt beim Hervorklauben des Portemonnaies
- Moment bitte -, hält dem wartenden Kondukteur das Generalabonnement
hin und zwingt sich, als dieser bereits bei den Nachbarn auf der anderen
Seite die Fahrkarten entgegennimmt, in eine aufrechte Haltung, das Hinterteil
an die Rückenlehne gepreßt. Pavlos greift nach einer Marlboro,
inhaliert tief, wischt dann mit dem Ärmel eine Bogenbahn aus der
beschlagenen Fensterfront.
Tropfen stürzen aus der Schwärze und ziehen wie Sternschnuppen
fallende Spuren entlang der Scheibe, die im Widerschein der Waggonbeleuchtung
aufblitzen. Unmöglich zu erkennen, wo sich der Zug im Moment befindet,
als führe er durch einen Tunnel, der niemals endete, wie in einer
Erzählung von Dürrenmatt, die ihm, weiß der Kuckuck, weshalb,
gerade eben wieder einfällt. Vielleicht, weil sie das erste Stück
Literatur war, das ihn beeindruckte. Die Situation hat bestechende Parallelen,
bin doch selbst einer, der wie der Protagonist "obskure Wissenschaften"
studierte, damals, vor der Erkrankung, und ich bin wie dieser auf dem
Weg in den Gelehrtentempel. Nur daß mein Zug nicht in eine Hölle
fährt. Hoffentlich, spintisiert er weiter, denn jene Zugfahrt fängt
ja genauso alltäglich und unverdächtig an, und es gibt eigentlich
gar keinen Grund, weshalb der Zug jetzt nicht in eine Katastrophe fahren
sollte. Die kommt doch, wem sie widerfährt, aus heiterem Himmel.
Das Aschengerippe der abgeglimmten Zigarette hängt schief an der
Glut und fällt ihm, als er es abstreifen will, bei der ersten Bewegung
in den Schoß. Pavlos schießt aus dem Sitz und schüttelt
das Hosenbein. Der ältere Herr, der ihm auf der anderen Seite gegenübersitzt
und mit seiner Frau, Mänteln und kleinen Reisetaschen großzügig
vier Sitze belegt, lächelt ihm zu, als wollte er sagen, macht ja
nichts, und stochert in seiner Pfeife. Pavlos lächelt freundlich
zurück und setzt sich wieder und wendet sich dem Fenster zu, das
er erneut freiwischt. Jetzt sieht man genau, daß der Zug parallel
zur Autobahn fährt, denn dort zischen im Dunst der Wettergischt die
Lichter der Wagen, die dichtgedrängt im Stau stehen. Irgendwo da
draußen hat sich wohl in unsäglicher Banalität die Katastrophe
ereignet, an die er eben in seinem Kiff gedacht und die aus schwarzem
Himmel heraus ein Leben in den Asphalt gedrückt hat. Es schaudert
ihn. Man sagt doch, daß ein Gedanke, fest genug und immer wieder
gedacht, sich auch ereignen, manifestieren werde und daß überhaupt
alles, was denkbar ist, sich verwirklichen wird, wie zum Beispiel der
alte Menschheitstraum vom Fliegen, und wenn der Glaube dann doch nicht
ausreicht, Berge zu versetzen, nimmt man halt einen Trax oder die bloßen
Hände. Morgen, in der Zeitung wird dies Ereignis wie die anderen
kleinen, belanglosen Tragödien verlorenen Glaubens und Hoffens auf
Unversehrtheit in ein, zwei Sätzen abgehandelt werden und am Abend
zum Altpapier gelegt, wo sie dann rezykliert vielleicht als Klopapier,
nach dem Wisch durch die Spalte eines Hinterteils, den letzten Gang durch
die Abwässer ins unwiederbringliche Vergessen antreten.
Der freundliche Herr von nebenan stochert, scheinbar unschlüssig,
immer noch in seiner Pfeife und sucht den Blick seiner Frau. Die sitzt
auf der Vorderkante, die Beine hochgelegt an ihrem Mann vorbei, eine Zeitung
unter den Füßen, den Kopf gesenkt, vertieft in einen Krimi
von Agatha Christie. Das hat sich Pavlos erschielt. Es gibt nichts Kurzweiligeres
auf Zugreisen als zu versuchen, die Lektüre von Passagieren zu erspähen
und daraus Rückschlüsse über diese Personen zu konstruieren,
die dann zu deren Erscheinungsbild passen. Pavlos ist fest davon überzeugt,
daß die Bibliothek eines Menschen (falls überhaupt vorhanden,
die Beschaffenheit der Bücher? Sind sie neu oder alt, gelesen oder
nicht? Wo sind die abgegriffenen, zerlesenen Exemplare, was für Autoren
stehen in den Regalen?) vieles über ihn aussagen kann. Doch gerade
Krimis dieser Art lesen doch fast alle irgendwann einmal, erst recht auf
langweiligen Zugfahrten.
Dafür lassen die laufmaschenfreien, hellbeigen Strümpfe, unter
denen dunkles Beinhaar durchschimmert, das falten- und knitterfreie dunkelblaue
Kostüm, das sorgfältig drapierte Foulard in Rot, Blau und Grau,
das gerade fallende, ergrauende, mit Pagenschnitt versehene Haar auf eine
Person schließen, die äußerlich wie innerlich in makelloser
Ordnung lebt. Einzig ihr etwas aus der Form gegangener Körper, der
nicht ganz zu der vorbildlichen Erscheinung passen will, zeigt, daß
sie vor der Menopause resigniert und dies widerstandslos in ihr Weltbild
aufgenommen hat und diesen Makel als Bürde des beginnenden Alters
erträgt. Die reglose, entspannte Haltung - das kaum merkliche, ökonomische
Blättern mit dem Daumen an der Innenseite des Buches - verrät
die routinierte Leserin. Nur die linke große Zehe verweist mit willkürlichem
Zucken auf eine irgendwie geartete innere Spannung, die sich auf diese
Weise entlädt, und diese Spannung will Pavlos erst recht nicht auf
die Lektüre beziehen, weil er nämlich zu einem Teil diese Person
(und jetzt ist es an der Zeit, ihr einen Namen zu geben, so läßt
es sich leichter über sie spekulieren - nennen wir sie also Gerda)
mit einem kühlen Intellekt versieht, der weiß, daß die
klischeehaften Gestalten in Christies Kriminalgeschichten den Leser mit
kompromittierenden Aussagen über die Verdächtigen verwirren
und zu falschen Spekulationen veranlassen wollen. Dieses Wissen, das er
ihr zubilligt (Mutmaßungen sind immer auch Anmaßungen), bedingt,
daß Gerda wohl nie ein Buch zu Ende lesen würde, das ihre Grundfesten
(erlernte, rechtschaffene, korrekte Lebensweise) in Frage stellen könnte.
Bei Christie aber, das weiß Gerda, kommt immer wieder alles ins
Lot, und der Gerechtigkeit, das ist ihr wichtig, wird Recht verschafft.
Zum anderen Teil will Pavlos aber, daß sein Urteil, das er an ihrer
zuckenden Zehe festmacht, auf unbewußte, schreckliche Abgründe
zurückzuführen ist. Denn nichts ist ihm verdächtiger, nichts
schürt seinen Argwohn mehr als die makellose Glätte eines Menschen.
Chimären sind solche Gestalten, müssen es sein.
Unerträglich, so was! Zu klein für sein Leben. Da lobt er sich,
daß die Brüche in seinem Leben sich schon in jungen Jahren
einstellten und nicht erst mit 35, wie bei einem Schulkameraden, der ihm
in kiffseliger Stimmung sein Unglück klagte:
- Weißt du, es ist verrückt. Immer schon wollte ich Zahnarzt
werden und habe unheimlich dafür geschuftet. Jetzt habe ich alles,
wofür ich mich abgerackert habe. Eine tolle Frau, Lausbuben, eine
Villa mit Wellness-Zone im Schlafzimmer, drei Autos und riesige Hypotheken.
Jetzt frag ich dich, ist das alles, was von unseren Träumen übriggeblieben
ist? Hypotheken abzahlen und warten, bis alles vorüber ist?
Pavlos hatte geschwiegen. War er doch insgeheim neidisch auf seinen Freund,
der alles hatte, was man sich nur wünschen konnte und was Pavlos
genauso hätte erreichen können. Doch was blieb ihm, dem "Aussätzigen",
aus dem sozialen Getriebe an den Rand Gedrängten, Kreditunwürdigen,
als sich glücklich zu schätzen, denn wie konnte er wissen, ob
es ihm nicht genauso ergangen wäre.
Gegensätze ziehen sich an, sagt man, und diese beiden, Gerda und
ihr Mann, nennen wir ihn der Einfachheit halber Ralf, scheinen dies in
exemplarischer Weise zu erfüllen. Denn Ralf ist äußerst
schlank; der Typ Mann, der, wenn er einen Hund hätte, bestimmt einen
Windhund spazierenführte. Er trägt zerkratzte Timberlands, die
Socken, rot, sind auf die Knöchel gerutscht und geben die Sicht frei
auf unbehaarte, bleiche, käsige Haut. Lose und knittrig, wie seit
Tagen getragen, hängt die Hose, hellgrau, an seinen Beinen, die dadurch
noch schwächer erscheinen. Das Hemd, die obersten zwei Knöpfe
offen, erdfarben, irgendwie unpassend und wahllos aus dem Schrank geholt,
steckt in einem wollenen, ebenfalls roten Pullover mit V-Ausschnitt, entblößt
seinen hageren, geäderten Hals, aus dem grotesk ein riesiger Adamsapfel
hervorsteht. Müßig zu erwähnen, daß sein bereits
weißes Haar in Unordnung liegt. Zugegeben, Gegensätze beziehen
sich nicht unbedingt auf das äußere Erscheinungsbild, wobei
natürlich noch abzuklären wäre, inwieweit Physiognomie,
die Proportionen des Körpers (ist er korpulent, athletisch oder hager
und zäh?) bestimmenden Einfluß auf den Charakter und das Temperament
ausüben, oder anders gefragt, was wohl das ausschlaggebendere Moment
für die Ausbildung, das Wachsen und Vollständigwerden eines
menschlichen Wesens ist - die Form oder dessen Inhalt. Ein weit darüber
hinausweisendes Problem, bei dem Pavlos bei einer Gelegenheit wie dieser
ins Grübeln gerät.
Ralf schmaucht seit etwa drei Minuten seine Pfeife, oder besser gesagt,
er kaut auf ihr herum und zieht immer nur kurz daran. Zwischen Gerda und
ihm ist kein einziges Wort gefallen, und ein Austausch der Blicke, darauf
hat Pavlos genau geachtet, hat nicht stattgefunden.
Ralfs Bauch beginnt sich zwei-, dreimal in leichtem Krampf zusammenzuziehen,
die Schultern wölben sich jedesmal leicht vor, der Mund, aus dem
er die Pfeife entfernt, verschließt sich verkniffen, das gelbliche
Weiß seiner Augen beginnt zu glänzen, wirkt wäßrig.
Dann das erste Husten, das am verschlossenen Mund vorbei seinen Weg durch
die Nase sucht und mit einem Geräusch entweicht, welches einen Ton
der willkürlich schwingenden Stimmbänder mitträgt. Doch
der Versuch, das sich Anbahnende im Ansatz zu ersticken, wird gleich darauf
zunichte gemacht. Ein tiefer Atemzug, der auf das heftige Auspressen der
Luft erfolgt, löst einen krampfhaften Hustenanfall aus, der den ganzen
Körper erbeben läßt, ihn zusammenklappt und wieder hochstößt,
daß Ralf nicht mehr an sich halten kann. Das Husten, einem Bellen
gleich, holt immer tiefer aus, als wolle es die Lungenflügel herausstülpen.
In Ralfs Gesicht vollzieht sich eine dramatische Wandlung. Die unbeteiligte
Stirn erscheint auf einmal gelblich über den Wangen, die jetzt blutleer
und lakenweiß eine bläuliche Äderung zeigen. Die Lippen
werden gänzlich blau, Panik verzerrt das Gesicht. Er quält sich
aus dem Sitz und verzieht sich auf die Toilette. Wird er sich übergeben
müssen?
Pavlos hat während dieser Zeit gebannt den Atem angehalten. Noch
nie hat er bei jemandem solch einen Hustenanfall miterlebt. Er ist fasziniert
und gleichermaßen schockiert. Armer Kerl, denkt er. Die zweite Marlboro
schmeckt auf einmal bitter, und er drückt sie, noch nicht zur Hälfte
geraucht, in den Aschenbecher an der Lehne. Schlaff tappen Ralfs Schritte,
als er nach einer Weile wieder ins Abteil zurückkehrt, gebeugt vor
Erschöpfung. Vorsichtig setzt er sich und wischt langsam mit einem
Taschentuch das tränen- und schweißüberströmte Gesicht
und den Mund, greift nach der Pfeife - Nicht schon wieder! denkt Pavlos
- und sinkt zurück, für eine Sekunde. Doch die erhoffte Erlösung
bleibt aus. Beim ersten Versuch, entspannt durchzuatmen, packt ihn mit
noch größerer Urgewalt ein weiterer Hustenanfall. Ein Mann
aus den hinteren Reihen steht auf und wechselt den Waggon. Das ganze geht
ihm zu sehr an die Nieren. Ist wohl eine Zumutung, den Kampf dieses Gezeichneten
miterleben zu müssen, und Gerda, ja die liebe Gerda, sie geht das
ganze anscheinend nichts an, denn sie hat immer noch nichts Besseres zu
tun, als in ihr Buch zu starren.
Das ist doch nicht zu fassen, entrüstet sich Pavlos, dein Alter ist
dabei zu ersticken und du liest in aller Seelenruhe deinen blöden
Krimi. Vielleicht tut er ihr unrecht, vielleicht ist sie solche Vorfälle
mit Ralf gewöhnt, und vielleicht hat ihr sein Arzt eröffnet,
daß Ralf langsam, aber sicher an einem Lungenemphysem ersticken
wird. Aber als sie dann, ohne aufzublicken, ein Hustenbonbon hervorholt
und es Ralf mit sparsamer, beiläufiger, nachgerade unbeteiligter
Geste hinstreckt, hat Pavlos sie endgültig in den letzten Kreis der
Hölle verbannt. Er sieht sie, wie sie in ein, zwei Jahren am offenen
Grab die Kondolenzbekundungen der Trauergäste mit Fassung entgegennimmt.
Armer Ralf, arme Gerda.
Mit einem satten Plopp erzittern kurzzeitig die Scheiben des klimatisierten
Wagens. Der Zug hat bei der Einfahrt in einen Tunnel auf die plötzliche
Luftdruckdifferenz an seiner Außenhülle reagiert. Die Windgeräusche
werden lauter, aber dumpfer, gedämpft von den Tunnelwänden,
die sie reflektieren. Pavlos hat sich ob der tristen Gedanken, die ihm
dieser Tag beschert, sinnlos erschöpft. (Ist es wirklich nur dies
beschissene Wetter, das auf die denkbar trübste Weise den nahenden
Winter ankündigt und ihn zwingt, überall nur Abgründe zu
sehen, in und um sich?) Er versucht seinen Kopf zu leeren und lauscht
dem Knacken und Ächzen der nicht ganz fest verschraubten und verzahnten
Teile der Waggonkomposition. Vergeblich. Denn die Fahrt durch den Tunnel
bringt ihn unweigerlich zurück auf die Dürrenmatt-Geschichte,
die er kurzerhand seiner Laune unterworfen und in ein Heute projiziert
hat.
Wenn die Kraft der Gedanken wirklich Berge versetzen könnte, weshalb
hast du dann noch nie im Lotto gewonnen? Eine Gegenstimme, die die meisten
seiner Gedanken konterkariert, versagt heute kläglich. Seine Katastrophengeilheit
schreit nach einer anarchischen, chaotischen Macht, deren Jünger
er ist. Einer Macht, der er zum ersten Mal in Canettis Buch Masse und
Macht begegnet war und dessen Diskurs er zu seinem eigenen zu wandeln
begann. Wie oft hat er sich diese Macht herbeigewünscht, wenn er
zum Beispiel an einem schönen Frühlingstag kurz vor Auffahrt
die Bahnhofstrasse in Zürich hinunter zum See schlenderte. Wie wäre
es, wenn sich statt des Himmels für den Leib Christi der Boden unter
aller Füßen öffnete und die Kaufrauschseligen einfach
verschlang. Ein modernes, jüngstes, gottvergessenes Gericht, daß
ihnen die Augen aufgingen ob all der berechneten Verlogenheit, die am
Ende des Jahrtausends gerechte Kriege erzeugt, Ausbeutung zum Naturgesetz
erklärt, so daß sich die erste Welt in ihr globales Dorf zurückzieht
und dem großen Rest der anderen, näherrückenden Welt wie
weiland Obelix den Eingang durch das goldene Tor versperrt.
Pavlos wird doch nicht der einzige sein, der solches denkt. Und wenn,
sagen wir, ein Dutzend zur gleichen Zeit das gleiche dächten, würde
dies ausreichen, wenigstens für einen, der in ihrer Nähe wäre,
die Welt untergehen zu lassen? Er nimmt sich vor, morgen das vorausgesagte
Unglück in der Zeitung zu suchen.
Ralf hängt jetzt flach wie seine Atmung in der Bank. Falsch, denkt
Pavlos, setz dich aufrecht hin! Und wieder holt ihn jene Erinnerung ein,
welche ihn immer wieder in letzter Zeit, in der er öfters zur Kontrolle
ins Universitätsspital einberufen wird, überfällt.
An die Tage in jenem denkwürdigen März, wo sich schleichend
dieser Ausdruck über Pavlos legte, welchen er jetzt auf Ralfs Gesicht
wiederfindet. Dieser milchige, fiebrig nervöse Schleier aus kurzatmiger
Erregtheit und gleichzeitig schwindelnder Erschöpfung, die einen
partout nicht schlafen läßt. Am Anfang konnte, später
wollte er nicht wahrhaben, wie dies zweite Gesicht über ihn kroch
und ihn in ein Korsett zwang, welches seine Bewegungsfreiheit heimtückisch
wie der Erreger, der ihm zugrunde lag, kaum merklich und wie eine unterschwellige
Drohung einschränkte. Erst fiel ihm auf, daß er am Ende der
vier Stockwerke, die er zu seiner Einzimmerwohnung erklimmen mußte,
völlig aus der Puste war. Doch dies beunruhigte ihn nicht weiter,
da er am vergangenen Wochenende gleich in drei verschiedenen Clubs abgefahren
und dementsprechend ausgepowert in die Woche gestiegen war. Von da an
aber mußte er mit jedem weiteren Tag einen zusätzlichen Halt
einlegen, bis er auf jedem einzelnen Zwischengeschoß eine Atempause
machen mußte. Zudem schlief er nachts immer weniger. Eine innere
Unruhe, so meinte er, ließe ihn so stark atmen, daß er nicht
mehr einschlafen konnte. Und diesen trockenen, eigenartigerweise schmerzlosen
Husten schob er den Joints zu, ohne deren beruhigende Wirkung er gar nicht
mehr hätte schlafen können. Kein Wunder, daß er so mühevoll
die Treppen erklimmen mußte, wenn er schon früh morgens gerädert
aus den Federn kam. Es war an einem Mittwoch, an dem er verspätet
zur Uni aufbrach und deshalb das Velo nahm, um die verlorene Zeit (als
ob es das gäbe) wieder aufzuholen. Die Luft im dichten Morgenverkehr
war zum Schneiden, stickiger denn je, obwohl eine kühle Bise durch
die Straßen fegte. Am Rämibühl, der letzten Steigung,
mußte er vom Velo. Das hatte es noch nie gegeben. Leichenblaß
betrat er das Seminar, wo seine Kommilitonen gerade mit dem Professor
die Übersetzungsprobleme des Riverside Chaucer besprachen. In der
konzentrierten Stille nahm seine Atmung einen ruhigen und festen Rhythmus
an. Er fühlte sich endlich leichter und freute sich auf den Film,
zu dem er sich mit ein paar Kollegen verabredet hatte. Peter's Friends
hieß der Streifen. Als Pavlos das Rämibühl ohne in die
Pedale zu treten hinuntersauste, merkte er gar nicht, wie der Fahrtwind
ihm den Atem verschlug. Der rasende Puls, das heftig pochende Herz, das
die Halsschlagader tanzen ließ, das schwere, zähe Atmen, als
er im Foyer des Kinos in der dampfenden Menge vor der Kasse in der Schlange
stand - das war nur die Folge der großen Geschwindigkeit, mit der
er unterwegs gewesen war. Das Kino war berstend voll. Ein paar Leute saßen
sogar in den Gängen, und bis endlich nach Reklame und Vorschau die
Lichter gedämmt waren, hing auch schon eine atemfeuchte, schwere
Wärme in der Luft und senkte sich drückend auf die Leiber. Da
Pavlos knapp dran gewesen war, hatte er mit keinem mehr als einen flüchtigen
Gruß ausgetauscht, und als der Nachbar, der ihm den Platz freigehalten
hatte, den Schweratmenden von der Seite musterte und ihn fragte: - Woher
denn so gesprengt?, irrlichterte bereits auf der Leinwand eine andere
Welt, in der sich eines dieser typisch britischen Sittengemälde ausbreitete.
Auf einem Landsitz, einem ehrwürdigen viktorianischen Manor, versammeln
sich auf Einladung des Hausherrn ein paar über alle Kontinente verstreute
Jugendfreunde mit ihrem Anhang, Abkömmlinge der britischen upper
class. Das etwas unverhoffte, fröhliche Beisammensein artet, man
ahnt es, bald einmal aus.
Doch Pavlos war nicht mehr in der Lage, dem neurotischen Reigen auf der
Leinwand zu folgen, und in der Pause, in der eine angeregte Diskussion
über die Gestalten entbrannte und den möglichen Ausgang des
Films, stand er abseits, in sich gekehrt, bedrückt und wie abgetrennt
von den übrigen. Eine gläserne Glocke hatte sich auf ihn gesenkt,
unter der er die umstehenden Personen als Schemen wahrnahm, und von deren
Stimmen er nur noch wattierte, zusammenhanglose Wortfetzen aufschnappte.
Alles begann sich schwindelnd zu drehen. Er mußte raus, sofort.
Er zwängte sich durch die Menge. Die bedrängende Enge der beieinanderstehenden
Leiber schnürte ihn noch mehr ein, und die aufkeimende Panik versetzte
ihn in aggressive Stimmung, so daß er grob, die Ellbogen einsetzend,
das Freie suchte. Endlich draußen, hob sich die Glocke hinweg, und
die Kühle der hereinbrechenden Nacht besänftigte die feurigen
Wangen. Er hatte Fieber. Die frische Luft löste einen Hustenreflex
aus, bei dem endlich, endlich ein mit Luftblasen versetzter, milchig weißer
Schleim, der aussah wie Eischnee, den Lungen ein wenig Erleichterung verschaffte.
Der Schleier vor seinen Augen lüftete sich, der Tunnelblick, der
seine Beengung verstärkt hatte, weitete sich wieder zu einem normalen
Sichtfeld, und die vorher eingetrübten Farben ätzten plötzlich
in greller Schärfe die Augen, als sein Blick die blinkenden Neonlichter
der Reklamen streifte. Nochmals atmete er tief durch.
Nichts schmerzte, nichts reizte ihn mehr, und er streckte und spannte
die tauben Glieder, daß sie surrten, wie wenn er eben erst erwachte.
Er glaubte seine Sinne wieder beieinander. Dies zweite Gesicht war wie
weggesprengt, und als der Dreiklang, der bis auf die Straße hörbar
war, die Zuschauer zurück auf ihre Plätze rief, ging er als
letzter auf seinen Platz.
Die Luft im Saal war während der kurzen Pause kein bißchen
leichter geworden. Im Gegenteil. Diesmal war die Glocke, kaum hatte er
sich gesetzt, über ihn niedergegangen. Während alle anderen
gespannt dem Höhepunkt des Films entgegenfieberten, entglitt Pavlos
das Geschehen auf der Leinwand und um ihn herum, als säße er
ganz allein auf seinem Sitz festgezurrt, wie auf dem elektrischen Stuhl.
Und als eine Stimme von der Leinwand herab das Todesurteil sprach: - Ich
bin HIV-positiv, da war es, wie wenn einer den tödlichen Hebel betätigt
hätte und Pavlos mit elektrischen Stößen ins Nichts schleuderte.
Das war's. Was jede Faser in seinem Körper ihm über Wochen mitzuteilen
versucht hatte, mußte ihm eine irreale, überlebensgroße
Gestalt von da oben herab mitten ins Gesicht sagen. Das zweite, sein zweites
Gesicht zeigte sich nun, verhöhnte, verlachte ihn und prügelte
ihn aus dem Saal. Gebannt von der erschütternden Magie, die von der
Leinwand flutete, bemerkte niemand, wie Pavlos von seinem Sitz aufschoß
und durch das Dunkel dem Ausgang entgegenfloh. Er verlor jede Kontrolle.
Als könnte er entkommen, rannte Pavlos drauflos, fuchtelte abwehrend
mit den Armen, doch die Fratze war mächtiger. Nach hundert, zweihundert
Metern hatte sie ihn eingeholt, stülpte sich über ihn und zwang
ihn zu Boden. Besiegt, erschöpft und nach Luft ringend, lag er da.
Es kam eine unheimliche, feierliche, ernste Ruhe über ihn. Eine glasklare
Gefaßtheit verdrängte den Alptraum, der ihn zu Boden geworfen
hatte. Er war ein anderer, der da zu sich kam, als wäre er vom Himmel
gefallen und würde zum ersten Mal den feuchten Asphalt unter seinem
Körper riechen, das Dröhnen der Motoren, die auf Kopfhöhe
vorbeidonnerten, zum ersten Mal wahrnehmen und das Schaufenster, an dem
er schon tausendmal vorbeigegangen war, zum ersten Mal sehen. Ein aufmerksamer
Passant half ihm wieder auf die Beine und erkundigte sich besorgt nach
seinem Befinden.
Zu Hause dann stand er minutenlang vor dem Badezimmerspiegel und studierte
den jämmerlichen Kerl, der ihm da entgegenstarrte, bis dieser dann
in die Stille hinein sagte:
DU hast AIDS.
Es sollte noch eine schwierige Zeit verstreichen, bis er endlich ICH sagen
konnte.
Das Scheppern der Minibar, das ihr Kommen in Pavlos' Waggon akustisch
vorwegnimmt, rüttelt ihn aus dem quecksilbrigen Bett, in das er sich
in seinem Kiff bisweilen zur Ruhe legt. Sie wird gezogen von einem recht
großen und kräftigen Tamilen, und schon entblößt
er ein blendend weißes Gebiß, welches sein immer gleiches
Mantra, von dem seine Existenzberechtigung in diesem Lande abhängt,
Mal für Mal, Waggon für Waggon, Tag für Tag, Jahr für
Jahr abspult.
Kaffee, Tee, Sandwich. Wein, Bier, Mineral.
Pavlos ächzt leise, als er seine Glieder, erst Arme, dann Beine,
durchstreckt und sich dann auf dem Sitz neu bettet. Pavlos sticht es in
den Hintern, und während er sich zurechtrückt, denkt er, fast
schon unverschämt, diese gesunden weißen Zähne in diesem
eh schon attraktiven Gesicht. Das kommt sicher vom gesunden Essen auf
deiner Insel, das du gegen den Wohlstandsfraß eingetauscht hast.
Welche Ironie. Aber auch du zahlst deinen Obolus. Bei soviel asiatischer
Geduld und Genügsamkeit wird dir dein ehrliches Lächeln schon
noch zur Fratze gefrieren. Pavlos hat gar keine Lust, sich selber gerecht
zu sein, und denkt selbstgerecht in einem Stammtisch-Slang weiter. Oder
gehörst du zu denen, die in den Schlafsilos die Treppenhäuser
mit ihrem Kochgestank schwängern? Kannst froh sein, daß der
Druck von euch Braunen auf die Balkanvölker übergegangen ist.
Doch weil nie je etwas so einfach ist, wie auch immer es gedacht wird,
und weil Pavlos der intellektuellen Redlichkeit nicht nur verpflichtet
ist, obwohl sie einem damit die Möglichkeit zumeist benimmt, bequem
im geistigen Ohrensessel auszuruhen, sondern mehr noch, weil er sich damit
abgefunden hat, daß er sein eigenes, aus Dutzenden von eigenständigen
Zuschauern zusammengesetztes kritisches Publikum ist, geht er auf Distanz
zu sich und schaut auf sich und seinen zwickenden Schmerz, wie er verkrampft
bei sich ist und wie entspannt er doch zu sich kommen möchte und
selbstbewußt und zufrieden sein wie dieser Kerl, den er neidet,
und siehe da, kaum gedacht, tut's nicht mehr weh, und politisch korrekt
zollt er diesem Tamilen warme Sympathie.
Jetzt tausend Gedanken gleichzeitig, an Sanch, seinen indischen Freund,
der jetzt sicher bei gleichem Wetter in London sitzt. An diese Stadt,
die ihm so schmerzhafte Impulse versetzt hatte, in der er sich jedesmal,
wenn er da war, hineingeschleudert, aufgerieben und verändert ausgespuckt
vorfand. Vielleicht hatte es doch einen tieferen Sinn gehabt, daß
ich den Krücken zum Trotz nach London geflogen bin, nur um das Tagebuch
von Gombrowicz zu lesen auf Sanchs so gräßlich schönem
pinkfarbigen Teppich. Diesen Text, der eigentlich mit den ersten Zeilen
schon alles sagt, bevor er zu einem monumentalen Monolog aufbraust. Montag
bis Donnertag ein einziges Ich, Ich, Ich, Ich. Der Niesel, der Nebel,
Gombrowicz und du. War das ein herrlich surrealer, befreiender, ablenkender
Trip, fast eine sanft dahingleitende Flußfahrt auf der guten alten
MS LSD.
Dennoch. Genauso stark der schale Nachgeschmack, der sich als Quittung
für exzessives Lesen auf die Zunge legt, wie beim Ausnüchtern
von eben erst vollzogenem Drogengebrauch. Und dann dieses Gedicht von
Kavafis, das, kaum war er aus London zurück, ihn beim Wiederlesen
so getroffen hat, daß er es sich immer wieder vorsagen muß.
Für
einige Menschen kommt ein Tag,
An dem sie das große Ja oder das große Nein
Aussprechen müssen. Es zeigt sich gleich,
Wer das Ja in sich schon bereit hat ...
Und
der Tamile trägt dieses Ja mit seiner ganzen Haltung vor sich her,
während Pavlos, ohne es recht zu wissen, auf seinem unausgesprochenen
Nein sitzen bleibt.
Und dieses Nein beunruhigt Pavlos, weil er ihm keinen Namen geben kann
und den Schlüssel zur Rumpelkammer verloren hat, in die er all seine
Neins achtlos und leichtfertig, schweren Herzens und wohlbedacht hineingesteckt
hat. Und eigentlich wäre es an der Zeit, dort nachzuschauen und zu
kontrollieren, in welchem Zustand sie sich befinden. Doch Pavlos kennt
sich und seine Muster, nach denen er funktioniert. Und er sieht sich unter
Applaus seines Publikums und unter größten Mühen, all
diese Neins wie in einer Ausstellung plazierend und sie noch ins richtige
Licht setzend - nur, um nach all der Mühe, dem wahren Grund, der
Mutter dieser aller Neins, den großen Auftritt zu verweigern. Und
da liegt es doch, was er am meisten fürchtet, das Endgültige.
Darum treibt er auch das meiste mit größter Konsequenz bis
hart an seine Vollendung. Doch Sisyphos gleich läßt er dann
alles fahren. Nicht mal sterben hast du gekonnt, als man es dir so leicht
machte. Dann es lieber gleich lassen, denkt sich Pavlos, und wie nett
und passend doch dieser Hauptmann jetzt, der mit einem noch größeren
Ja als der Tamile bei jenem ein Bier bestellt.
Fesch und breitbeinig steht er vor dem Tamilen, leicht vorgewölbt,
als wolle er gleich, die Arme hinter dem Rücken verschränkt
und so den Wanst vom Schutz entblößt, seine absolute Sicherheit
demonstrieren, sich auf Zehenspitzen hieven, dem Subalternen seinen Wunsch
befehlen. Doch statt dessen entblößt auch dieser ein Lächeln
der Marke Pepsodent, als grüße er einen Kumpel mit größter
Selbstverständlichkeit, als verbände sie eine Entente, welche
keiner distanzierten Höflichkeit bedarf. Gleich wird er dem Tamilen
die Hand auf die Schulter legen, denkt Pavlos, ob da zwischen denen etwas
läuft, wär' das abwegig wunderbar. Doch nichts dergleichen geschieht.
Dafür gönnen sie sich ein paar angenehm empfundene Sätze,
denn noch immer lächeln sie vertraut, die beiden Heten, und Pavlos
sieht sie nackt unter der Dusche wie in der Rekrutenschule.
Dies kann Pavlos ohne mit der Wimper zu zucken, ohne irgendeinen sexuellen
Impuls zu empfangen, heute tun, konstatiert er befriedigt. Viel mehr stellt
er sich mit noch größerer Nüchternheit vor, was wohl geschehen
könnte, wenn er wirklich einfach nur mit den Fingern zu schnippen
brauchte, um diese beiden zu verpflanzen - währenddem der Tamile
seinem Gegenüber die Bierdose aushändigen wollte -, er sich
mit der Seife in der Hand, den Arm ausstreckend vorfände, im Duschraum
der Kaserne in Payerne, wo Pavlos mit dem Dutzend seines Zugs, jeweils
abends nach diesem so stumpfsinnigen physischen wie psychischen Drill
der Grundausbildung, hineingetrieben wurde wie heißglühender,
freundeidgenössischer, gehärteter Stahl, der zum Abschrecken
in ein kühles Becken getrieben wird ... was geschähe jetzt,
wenn das emotionale Moment, welches die beiden im Zug umhegt, mit ihnen
ginge, jedoch ohne Schutz und Konvention in ihren Uniformen, ihren Rollen
- und der Tamile, der nackte, schöne Wilde, dem Hauptmann, der keiner
mehr ist, sondern nur noch ein äußerst gut und attraktiv gebautes
Exemplar der Gattung Mann, mit der allergrößten Selbstverständlichkeit
die Seife hinüberstreckte? Könnte es da, wo sie sich jetzt auch
frei fühlten, bar jeder Konvention und Not, getragen noch vom Gefühl
in diesem Zug - könnte es da passieren, daß sie, obwohl sie
mit ihresgleichen bis dato nichts am Hut, nicht doch die Lust verspürten,
sich gegenseitig einzuseifen, ganz naiv erst, und dann mehr noch, Lust
aufeinander entwickeln, auf zwei schöne Körper, die sich einfach
lieb tun, ohne Arg? Pavlos, come down, du bist ein Arsch ...
Pavlos unterbricht für einen Moment seine Gedankendrift, die ihn
während der kurzen Zugfahrt bis hierher zu den beiden Männern,
die immer noch aufeinander einreden, begleitet hat. Etwas hat ihn aufgeschreckt,
und wie zur Bestätigung zwickt der Hintern. Er muß darüber
nachdenken, inwieweit er sich gewandelt hat, und wieviel noch von dem
tragischen Unschuldslamm, das schon dreimal um das gesichtslose Geschäftshaus
in Olten geschlichen war, in ihm geblieben ist? Eines ist klar, mit dem
großen Zeitabstand, der ihn vom Damals gefühlsmäßig
trennt, betrachtet er die Dinge allgemein gelassener, mitunter abgeklärt.
Er kann sich besser abgrenzen heute, ganz allgemein, und das nennt man
wohl Reife, wobei ihm der Verdacht kommt, daß dies nur ein anderer
Ausdruck für Bequemlichkeit ist. Denn ein Seelensturm wie dieser,
in dem er sich damals befand, wäre er nicht wiederzufinden an den
Grenzen seines Reiches, hinter denen er sich etabliert hat? Ist er einfach
zu faul, das Bündel neu zu schnüren, um die Gebiete zu erforschen,
die noch unentdeckt sind, wie damals, mit zwanzig, als jede Erfahrung
noch eine Grenzerfahrung war? Ist er nicht in gewisser Weise abgefuckt,
abgeschliffen vom Leben, Burgherr einer Ruine? Dafür vibriert er
heute eindeutig langsamer, weniger haltlos weit, dafür vielleicht
bodenlos tiefer, ja das ist es. Und gleich ist ihm wieder wärmer,
bequemer in seinem Leben, und es fällt ihm leichter, wieder auf den
vor Erwartung zitternden Jüngling zu sehen, wie er den alles entscheidenden
Klingelknopf drückt und das Surren der Türverriegelung vernimmt,
das das Sesam öffne dich begleitet. Wie er nach zehn Minuten, in
denen er sich mit der größten zur Schau gestellten Ruhe ausgezogen
hat, mit rasendem Puls und gespreizten Beinen im Dreipersonendampfbad
auf der Kunststoffbank sitzt. Der Dampf ist mit zuviel Menthol versetzt,
daß Pavlos trotz der Hitze eine Gänsehaut kriegt. Die Tür
vor ihm geht auf und schließt sich gleich wieder hinter dem entweichenden
Dampf, der die hereingeschwebte, mit blonder Fönfrisur gekrönte
magere Gestalt, der Alb seiner Träume, verhüllt. Pavlos ist
gerade dabei, sich ein Bild von der Figur zusammenzureimen, als er noch
kapiert, wie diese sich unvermittelt zwischen seine vergessenen, gespreizten
Beine kniet und sein Glied, welches zu spüren ihm in seiner Erregung
abhanden gekommen war, mit Aufundabbewegungen zu verschlingen beginnt,
schon verströmt er, und eh er zu sich kommen kann, ist die Gestalt
auch schon verschwunden. Er wartet eine Weile, daß die Erregung
nachläßt, bevor er unter die kalte Dusche kann. Doch sein Glied
will nicht weichen, pocht mit pulsierendem Schmerz. Da geht die Türe
ein zweites Mal auf, diesmal eine große und muskulöse Gestalt,
die sich mit einem Blick der Situation bemächtigt und mit noch größerer
Leidenschaft und Vehemenz ihm dasselbe widerfahren läßt. Und
schon ist auch sie weg. Als Pavlos nach zähen Minuten, in denen er
seine Haltung wiederfindet, unter die kalte Dusche geht, sind die anderen
beiden verschwunden. Statt mit Weihrauch und Becken, wie in einer orthodoxen
Taufe, walteten bei Pavlos' so stark herbeigesehnter Einweihung zwei anonyme
Priester, die sich mit Dampf und Plastik begnügten.
Pavlos grinst vor sich hin, wenn er auf sich sieht, wie er damals auf
dem Nachhauseweg die geballte Faust gen Himmel schnellen läßt,
einen Freudenschrei ausstößt und gleichzeitig leichtfüßig
und weit und fest vor sich ausschreitet. So wenig brauchte es, um ihn
zu beglücken. Jetzt war er also ein Mann.
Dies Grinsen nimmt Ralf, der sich anscheinend wieder ein bißchen
gefangen hat, zum Anlaß, es hämisch zu erwidern, rollt dazu
die Augen Richtung Tamilen, der gerade die Visitenkarte einsteckt, die
ihm der Hauptmann offen hingestreckt hat. Pavlos braucht zwei, drei Sekunden,
bis er begreift, daß dieses schäbige Grinsen nicht auf seine
Gedanken gemünzt ist, ob deren ihm diese Geste, wo zwei sich finden
zu vielleicht einem neuen Kapitel in ihren so unterschiedlichen Leben,
beinahe entgangen wäre ohne die Mithilfe von diesem Ralf, für
den Pavlos' Mitgefühl schlagartig in ein Mitleid für diesen
Tolpatsch umschlägt.
Pavlos wendet sich ab mit einem Gesicht, das zu einer nichtssagenden Maske
einfriert. Ralf ist ihm entfallen. Er will sich nicht mehr mit dem armen
Kerl auseinandersetzen, der mit zu einem grotesk in die Länge gezogenen
Gesicht die Maske der unbelehrbaren Beschränktheit herausläßt.
Wie kann es sein, daß du mit deinem kranken, sensiblen Körper
nicht mehr Milde walten lassen kannst? Du scheinst deine Herzensdame redlich
zu verdienen, ihr paßt zusammen, spricht Pavlos seinen stummen Nekrolog
auf Gerda und ihren Mann und wendet sich definitiv das letzte Mal von
ihnen ab und seinen Marlboros zu.
Patrick Konkontis
Zitate der Rede im üblichen Rahmen sind möglich und honorarfrei. Die Verwendung von weiteren Ausschnitten müssen mit dem Verfasser, dem Tagungsbüro oder dem Piper-Verlag geklärt werden.
© 2000 ORF Landesstudio Kärnten.